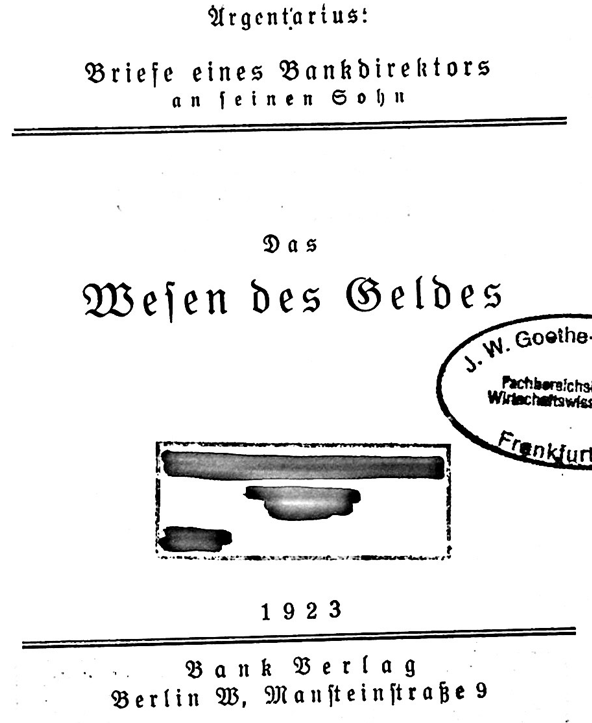
I. Teil: Vom Gelde
1. Brief
Two nations – Das Verbrechen der Unkenntnis
Berlin, in der Sylvesternacht 1920/21.
Mitternacht. Draußen, lieber James, läuten die Sylvesterglocken wieder einmal ein tolles Jahr zu Grabe. Ein weihevoller Moment für die Menschen, die sich die Stunden ihrer inneren Erhebung vom Kalender vorschreiben lassen. Disraelis „two nations“, die beiden großen Völker, in die jeder sogenannte Kulturstaat sich spaltet, leben in diesem Augenblick ihr Dasein doppelt intensiv. Der Reichtum steigert sein Wohlleben in Wein, Tanz und Spiel bis zum Rausch; ich blicke ihm von meinem Arbeitszimmer aus in die festlich blitzenden Fenster. Die Armut, die ich nicht sehe, weil sie sich in weit entfernten Stadtvierteln zwischen ihre kahlen vier Wände verkriecht, bringt dem neuen Jahr das schuldige Opfer, indem sie die Tränen des Alltags doppelt reichlich fließen lässt.
Ich selbst habe, wie Du weißt, keinen Sinn für Feierlichkeit. Aber ganz kann ich mich der Magie der Sylvesternacht dennoch nicht entziehen. Sie zwingt mich zur inneren Sammlung, zur geistigen Einkehr, und manche unklare Empfindung in mir nimmt feste, scharf umrissene Gestalt an.
Ich sehe mich gleichsam auf dem schmalen Grat stehen, der die beiden großen Völker in unserem Vaterlande trennt, die Tanzenden hier, die Weinenden dort. Und indem ich hinunterblicke in dieses zweigespaltene Leben und Treiben, ist es mir, als könnte ich deutlich alle Hebel und Räder des großen Mechanismus erkennen, der die sozialen Verhältnisse der Länder und Kontinente bestimmt und der dem profanen Auge meist verborgen bleibt. Mein von der Weihe des Moments geschärfter Blick übersieht die wirtschaftlichen Gesetze, die Reichtum und Armut entstehen, anwachsen, Stillstehen oder abnehmen lassen. Ich sehe, wie unter bestimmten Voraussetzungen die Scheidewand zwischen dem Volk der Besitzenden und dem der Besitzlosen sich hebt oder senkt. Und mit erschreckender Klarheit drängt es sich mir auf, wie verhängnisvoll jene ewigen Wirtschaftsgesetze gerade in dem eben abgelaufenen Jahre wirksam gewesen sind: Um ein ungeheures Stück hat sich die schroffe Scheidewand zwischen den beiden Völkern eines und desselben Landes erhöht. In verdreifachter Menge fließen diesseits die Tränen, jenseits der Wein. Und zugleich mit der Scheidewand wächst aus; dem uralten Groll der beiden Völker, die einander niemals verstehen werden, ein ungeheurer Hass empor, der eines Tages die Kulturwelt in Trümmer legen wird, wenn man seine Ursachen nicht noch rechtzeitig beseitigt.
In dieser klaren Erkenntnis, die ich aus dem Klange der Sylvesterglocken schöpfe, setze ich mich an meinen Schreibtisch, um mich mit Dir, mein lieber James, wieder einmal auszusprechen. Ich habe in dieser Stunde den Entschluss gefasst, den Faden von neuem aufzunehmen, den ich vor Jahren habe fallen lassen; die instruktiven Briefe, die ich Dir vor dem Weltkriege gesandt habe, sollen ihre Fortsetzung finden. Docendo discimus: Wer andere belehrt, lernt selbst. Ich will mir über manche Dinge klar werden, indem ich mich zwinge, sie Dir klar zu machen. Und umgekehrt ist es meine väterliche Pflicht, das Wissen, das ich in jahrzehntelanger Berufstätigkeit gesammelt habe, so vollständig wie möglich auf Dich, den Sohn, zu übertragen. Es stände manches besser in der Welt, wenn jede Generation es mit dieser Pflicht ernst nehmen würde, und wenn es selbstverständlich wäre, daß die Summe der väterlichen Kenntnisse regelmäßig das Wissens-Fundament des Sohnes bildete, dem dieser dann ein neues Stockwerk für seine eigenen Nachkommen hinzuzufügen hätte. Auf diese Weise entsteht ein Erbbesitz von Kenntnissen, der gleich wertvoll für den Einzelnen wie für die Gesamtheit ist. Wohl dem Staate, der die Gewissheit hat, daß in jedem Angehörigen eines bestimmten Berufs sich die Summe der Erfahrungen seiner Vorfahren verkörpert! Er findet überall gefestigte Traditionen vor und weiß ohne weiteres, wo er seine Regenten, seine Diplomaten, seine Offiziere, seine Richter und seine Beamten zu suchen hat. Er braucht nicht zu experimentieren und die Klassen durcheinander zu schütteln. Ich weiß sehr wohl, mein Sohn, daß dies Deinen freiheitlichen Anschauungen nicht entspricht, und mache keinen Versuch, Dich zu bekehren. Die Bekehrung kommt von selbst, wenn Du erst in meinen Jahren bist. Dann wirst Du die tiefe Weisheit des altägyptischen und indischen Kastenprinzips ahnen, das jeden Menschen da belässt, wo er wurzelt, wo er die seiner Konstitution entsprechenden Daseinsbedingungen vorfindet und dem Ganzen mit seiner ausgeglichenen Person am besten nutzt.
Du bist der Sohn eines Bankdirektors und selbst künftiger Bankenleiter. Es würde auf mich zurückfallen, wenn Du das Instrument, das ich Dir eines Tages anvertrauen werde, dieses volkswirtschaftlich so hochwichtige Instrument, stümperhaft handhaben solltest. Wer eine Bank leiten will, muss vor allen Dingen wissen, was eine Bank ist; muss wissen, welche Rolle das Bankwesen eines Landes innerhalb der nationalen Gesamtwirtschaft spielt muss sich bewusst sein, daß bestimmte Funktionen der Banken nicht nur ganz bestimmte ökonomische Wirkungen, sondern auch einschneidende soziale und politische Folgen haben. Das alles erkennt aber nur Derjenige, der die Gesetze des Kapitalmarkts beherrscht, der genau weiß, unter welchen Bedingungen die Produktivität eines Landes sich zu Kapital verdichtet, und wie die einzelnen Verwendungsarten des Kapitals auf die Produktivität des Landes zurückwirken. Hier hat der Mechanismus des arbeitenden Volksganzen seine eigentliche Triebfeder, hier entscheidet sich das wirtschaftliche Geschick des Staates, hier liegt der soziale Keim, der eine und dieselbe Nation in zwei feindliche Völker auseinandersprengt. Es gibt nur einen Weg, mein Sohn, der zur vollen Klarheit hierüber führt, und am Ausgangspunkt dieses Weges steht das Geld. Wenn es heute so wenig Leute, auch unter meinen eigenen Kollegen, gibt, die das tiefinnerste Wesen und Wirken des Kapitalmarkts und der ihn dirigierenden Banken erfassen, so liegt das einzig und allein daran, daß es um die Kenntnis vom Gelde heute so bitterböse bestellt ist.
Bis vor ein paar Jahren hat sich außer den wenigen Fachgelehrten niemand mit dem Geldwesen beschäftigt, und diejenigen, die es getan haben, sind im rein Theoretischen und Abstrakten stecken geblieben. Ganz erklärlich: Es hat ja seit Jahrzehnten an einer zwingenden Veranlassung gefehlt, sich mit dem höchst konkreten Gelde, das lebendig durch alle Märkte pulsiert, eingehender zu beschäftigen. Wie die beste Frau diejenige ist, von der man am wenigsten spricht, so ist vor dem Kriege auch vom Gelde deshalb so selten gesprochen worden, weil es in allen Kulturländern brav und bieder seine Schuldigkeit tat. Das Geld war eine Selbstverständlichkeit, von der man nicht viel Worte zu machen brauchte. Sogar die Nationalökonomen, für die es eigentlich nichts Selbstverständliches gibt, ließen sich von der Hausfrauentugend des Geldes täuschen. Ihre neueren Schulen stellten Theorien auf, die man nur mit Kopfschütteln lesen konnte, wenn man sich der berühmten Assignaten aus der französischen Revolution und der sonstigen Jugendsünden erinnerte, die das brave Geld auf dem Gewissen hatte.
Die maßgebende Ansicht vor dem Kriege war, daß das Geld eine reine Zweckmäßigkeitseinrichtung des Staats sei, etwa wie die Polizei und das Paßwesen, nützlich, aber nicht unentbehrlich. Man könne mit Geld wirtschaften aber auch ohne Geld. Auf seine äußere Gestalt und seinen inneren Wert komme es absolut nicht an. Der Staat sei souveräner Herr über das Geld, das er aus jedem Stoff, den er für geeignet halte, und in jeder Menge, die er als erforderlich erachte, herstellen könne. Auch du, lieber James, hast damals das Geld für nichts anderes als ein Geschöpf der staatlichen Rechtsordnung, oder, was in diesem Falle daßelbe ist, der staatlichen Willkür gehalten. Ich habe Dich trotz aller Bemühungen keines Besseren belehren können. Du wolltest genau so wenig wie die Anderen einsehen, daß der Staat im Grunde gar nichts mit der Entstehung des Geldes zu schaffen hat, und daß er, wenn er sich dennoch schöpferisch betätigt, das Geld fast regelmäßig ruiniert.
Inzwischen hat sich in ganz Europa, und nicht zuletzt in Deutschland, die allgemeine Unkenntnis in Gelddingen furchtbar gerächt. Vom Gelde ausgehend haben soziale Umwälzungen stattgefunden, die sich eines Tages vielleicht noch folgenschwerer erweisen werden als die politischen Veränderungen, die der Weltkrieg hervorgerufen hat. Große Ursachen, kleine Wirkungen: Auch Dein Unglaube ist erschüttert worden. Das Samenkorn meiner Belehrung fällt heute auf empfänglicheren Boden als noch vor zwei Jahren. In einem Deiner letzten Briefe bittest Du mich selbst, ich möchte Dir ein Fensterchen öffnen, durch das Du einen Einblick in den verborgenen Mechanismus des Geldwesens gewinnen könntest. Nun, ich will versuchen, Dir das Fenster so weit aufzutun, daß Du das gewaltige Gebäude des Geldverkehrs vom Fundament bis zum Giebel übersehen kannst. Der Weg soll der altgewohnte sein: In einer Reihe von Briefen werde ich Dich etappenweise durch die Gebiete des Geldes, des Kredits, des Kapitals und des Bankwesens führen, bis Du die großen Zusammenhänge zwischen ihnen erkennst und damit den Ausgangspunkt gewinnst, von dem aus Du durch eigenes Nachdenken den Weg in das Innere der einzelnen Teilprobleme findest. Und zwar sollen die Briefe schnell aufeinanderfolgen, denn es eilt mir mit der Belehrung nicht minder wie Dir mit dem Lernen.
Warum? Weil ich müde bin, lieber James, weil ich bald abdanken will. Ich bin ein Mann der alten Schule und passe nicht in die neue Zeit. Arbeit, Pflichtbewusstsein und Disziplin – Du weißt, daß ich ohne diese drei Elemente nicht wirken kann. Kleine Konzessionen habe ich selbstverständlich oft machen müssen; lieber Himmel, ich bin ein Bankdirektor! Aber die Wirtschaft, an deren Fortentwicklung ich mitarbeiten soll, muss als solche einigermaßen gesund sein. Das große Weltgesetzbuch, das richtig verstanden und angewandt alle Spezialgesetze entbehrlich macht, – ich meine das Zweitafelgesetz vom Berge Sinai – muss auch im Wirtschaftsleben respektiert werden. Das ist heute nicht der Fall. Wir leben im Zeitalter des organisierten Diebstahls; eines so raffinierten Diebstahls, daß der Geschädigte kaum merkt, wie er bestohlen wird, und der Dieb seine Finger gar nicht zu beschmutzen braucht, um fremdes Gut an sich zu bringen. Der Vorgang, der das Eigentum vogelfrei macht, erscheint dem einfältigen Auge als eine elementare, dem menschlichen Einfluss entrückte Schicksalsprüfung, die man gottergeben hinzunehmen hat. Nur wenige ahnen, daß das vermeintliche Naturereignis in Wirklichkeit nichts anderes ist als ein roher Willkürakt der Menschen, den man frevelhaft nennen müsste, wenn hier nicht Christi Wort gälte: „Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Sie wissen es wirklich nicht, weil sie nicht wissen, was Geld ist. Es klingt wie eine Profanierung, aber es ist so. Die Unkenntnis vom Gelde wird hier tatsächlich zur epidemischen Unmoral.
Daß inmitten dieses Hexensabbats das Bankgewerbe unfreiwillig im Reigen der Profitierenden mittanzt, widert mich am meisten an. Es scheint zwar eine Art Naturgesetz zu sein, daß die großen sozialen Krisen, in denen das Proletariat sich auf bäumt, die fettesten Tage für das Kapital sind; niemals sind ja Riesenvermögen schneller entstanden, als in der großen französischen Revolution. Aber die Banken sind meiner Meinung nach dazu da, der rechtswidrigen Neuverteilung des Eigentums entgegenzuwirken, nicht dazu, Helferdienste bei ihr zu verrichten. Mit Schrecken sehe ich, wie heute die Banken die „neuen Reichen“ noch reicher machen, indem sie ihnen ihre Mittel zur Verfügung stellen, nach dem Wort: „Wer da hat, dem wird gegeben“; und wie sie die Verarmten völlig verelenden lassen, indem sie ihnen den letzten rettenden Strohhalm, den Kredit, entziehen. Ich sehe, wie die Banken in der Not der Zeit Fett ansetzen, gleich Aalen im leichenüberfüllten Sumpf. Ich sehe, wie viele meiner Kollegen, statt praktische Rettungsarbeit zu verrichten, einer widerwärtigen Art geschäftigen Müßiggangs frönen, indem sie sich an dem nutzlosen Geschwätz der Utopisten beteiligen, die da glauben, nach wohldurchdachten Plänen eine funkelnagelneue Wirtschaft aufbauen zu können, damit aber nur verraten, daß sie das wirtschaftliche ABC nicht kennen. Mag sein, daß alles das unvermeidliche Begleiterscheinungen unserer Zeit sind, und daß in diesem Punkte die Jahre nach den großen Kriegen und Revolutionen einander notwendig gleichen. Mich widert es jedenfalls an. Ich habe Sehnsucht nach jenen harmlosen Tagen, in denen es zu den größten Verbrechen zählte, wenn eine Bank einmal einen erlittenen Verlust in ihrer Bilanz verschwinden ließ oder die Beschlüsse einer Generalversammlung zu ihrem eigenen Nutzen beeinflusste. Quel bruit pour une omelette! Wie wichtig nahm man den Kleinkram! Heute vollziehen sich wirtschaftliche Verbrechen von unermesslicher Tragweite unerkannt und ungesühnt, begleitet von einem melodischen Redestrom einschläfernden Unsinns.
Also nicht lange mehr, und ich lege das Steuer in Deine Hand, lieber James. Deine Spezialkenntnis des Bankwesens im technischen Sinne ist zwar noch ziemlich klein, aber sie reicht nach Lage der Dinge für die Leitung einer Großbank aus. Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand. Du wirst später sehen wie wahr das Wort ist. Dem Bankdirektor, der ja fast immer ein Gebender ist, öffnen sich bereitwillig alle Quellen des technischen, kaufmännischen und finanziellen Wissens. Jeder Industrielle, jeder Großhändler, jeder internationale Geschäftsvermittler, jeder Finanzminister eines geldbedürftigen Staats, kurz jeder, der das Geld Deiner Bank braucht, wird, ohne es zu wissen, Dein Lehrmeister. Die sechzig Aufsichtsratsstellen, die ich Dir nach und nach abtreten werde, bedeuten für Dich in geistiger Beziehung fast noch mehr als in materieller eine große Einnahmequelle. Und für die Detailkenntnisse sind Deine Beamten da.
Aber in einem Punkte bedarf unbedingt Dein intellektuelles Rüstzeug noch der Ergänzung: Du musst wissen, auf welchem Instrument Du spielst. Wer mit Millionen und Milliarden manipulieren will, muss wissen, was Geld ist. Wer eine Bank leitet, das heißt am Schaltbrett der nationalen Energien steht, muss den Strom kennen, den der Druck seiner Hand auslöst, muss wissen, wie dieser Strom sich über die Wirtschaft verteilt, und wie er innerhalb derselben wirkt. Man kann zwar das Schaltbrett auch mit äußerlicher Routine bedienen, ohne mehr als die unmittelbar sichtbaren Wirkungen zu übersehen. Aber wenn dies allgemein geschieht, wenn alle großen Banken von Männern mit Scheuklappen geleitet werden treibt die Wirtschaft in Katastrophen hinein.
Du sollst also, mein lieber Sohn, den Mechanismus begreifen, vor dem Du in nicht ferner Zeit stehen wirst. Ich kann Dir allerdings nur die Grundlage, sozusagen den logischen Knochenaufbau liefern, den Du mit dem Fleisch Deines eigenen Nachdenkens umkleiden musst; keine Eselsbrücke zur praktischen Auflösung der in Deinem künftigen Beruf vorkommenden Rechenexempel. Trotzdem wird diese geistige Erbschaft, die Du schon bei meinen Lebzeiten antrittst, vielleicht der wertvollste Teil meiner ganzen Hinterlassenschaft sein. Und das will bei einem Bankdirektor, der zwei fette Revolutionsjahre mitgemacht hat, immerhin etwas besagen.
In Liebe
Dein alter Papa.
2. Brief
Wirtschaftsverkehr ist Tauschverkehr – Tauschverkehr bedingt Kredit – „Kredit“ und „Geld“
Berlin, am 2. Januar 1921.
Wie kommt es, lieber James, daß die Menschen unter denen sich doch auch kluge, selbständig denkende Leute befinden, das Wesen des Geldes so schwer ergründen können? Ich glaube, es kommt daher, daß sie von Kindesbeinen auf mitten im Gelde leben, zu eng mit ihm verwachsen sind und daher nicht die nötige Distanz zu ihm finden. Das Geld verrichtet eine bestimmte Punktion im täglichen Leben, nämlich die Punktion des Kaufens und Bezahlens, mit solcher Selbstverständlichkeit, daß man nur schwer von der Vorstellung loskommt, das Geld und die Punktion seien ein und daßelbe. Und der Sprachgebrauch bestärkt uns in dieser Vorstellung. Wenn wir einen gewissen Dickhäuter mit einem langen Rüssel „Elefant“ nennen, so kann kein Zweifel daran bestehen, daß ein Elefant nichts anderes als dieser gewisse Dickhäuter mit dem langen Rüssel ist. Und wenn wir alle Dinge, mit denen wir im Alltagsleben kaufen und bezahlen, „Geld“ nennen, so ist Geld natürlich nichts anderes als das Ding, das jeweils als allgemeines Kauf- und Zahlmittel dient. Ob es sich dabei um Goldmünzen oder papierne Scheine, um Salzbarren oder Kaurimuscheln handelt, ist gleichgültig, solange man nur in seinem Lande damit kaufen und bezahlen kann, denn alles, womit man das zu tun vermag, nennt der Sprachgebrauch „Geld“.
Hinter dieser allbekannten Punktion steckt aber ein verborgener Sinn, ein Gesetz. Ganz wie hinter dem Vorgang des fallenden Steins, des rollenden Rades bestimmte Naturgesetze stecken. Diesen Gesetzen kommt man nicht auf die Spur, solange man ein Rüsseltier Elefant, und den Elefanten ein Rüsseltier nennt, sich also begrifflich immer im Kreise dreht. Wenn man sich aber vergegenwärtigt, was allen Vorgängen und Punktionen einer bestimmten Art gemeinsam, was das Typische in ihnen ist, so kommt man sehr schnell hinter ihre tiefere Bedeutung und hinter die Gesetze, denen sie gehorchen.
Denke also, lieber James, jetzt einmal nicht an das Geld, das den Verkehr vermittelt, sondern überlege Dir, welchen Sinn der wirtschaftliche Verkehr zwischen den Menschen als solcher hat. Dann drängt sich Dir zunächst eine Beobachtung auf, die schon, viele Menschen vor Dir gemacht haben: daß nämlich dieser Verkehr im Grunde genommen nur ein Tauschverkehr ist. So kompliziert unser Wirtschaftsleben auch aussieht, letzten Endes läuft es doch lediglich darauf hinaus, daß täglich zahllose Gegenstände für den Verbrauch hergestellt und zu diesem Zweck zwischen Herstellern, Händlern und Verbrauchern ausgetauscht werden. Wer auch immer eine Ware verkauft oder eine Leistung anbietet, immer kommt es ihm darauf an, andere Waren oder andere Leistungen dafür zu erhalten. Mache einmal die Probe. Blicke um Dich herum und prüfe, woraus sich das Vermögen Deiner Nachbarn zusammensetzt, das heißt, was sie für ihre Jahrzehnte lang geleistete Arbeit eingetauscht und aufgesammelt haben. Was siehst Du dann? Du siehst Häuser, Möbel, Kunstgegenstände. Ferner siehst Du Maschinen, Wagen, Schiffe. Endlich siehst Du Gegenstände des täglichen Bedarfs, nämlich Vorräte an Kleidung, Wäsche, Fleisch, Brot. Alle diese Dinge sind der wirkliche Gegenwert für die Waren, welche Deine Nachbarn verkauft, und für die Arbeit, die sie geleistet haben.
Bei vielen Leuten wirst Du allerdings auch Vermögensbestandteile unkörperlicher Natur sehen, die von ganz besonderer Art zu sein scheinen, nämlich Aktien, Obligationen, Hypotheken und ähnliche Dokumente. In Wirklichkeit unterscheiden sich diese Vermögensteile aber in nichts von den konkreten Gegenständen. Jede Aktie, jede Obligation, jede Hypothek stellt höchst körperliche Häuser, Maschinen, Wagen oder Vorräte vor, die sich irgendwo befinden, und die den Gegenwert der vom Aktionär oder Obligationär verkauften Waren oder geleisteten Arbeit bilden. Nur daß diese Häuser, Maschinen usw. sich nicht im unmittelbaren Besitz des Aktionärs oder Obligationärs befinden. Statt ihrer hat sie irgend ein Dritter im Besitz oder in der Verwaltung, und Jene haben einen entsprechenden Anspruch an ihn, der in den Aktien, Obligationen und sonstigen Dokumenten verbrieft ist. Der Sprachgebrauch nennt einen solchen Anspruch „Kapital“ und das jährliche Entgelt, das der Verwalter für die Überlassung der Häuser, Maschinen usw. entrichten muss, „Zins“. Auch bei diesem Zins, dem man aus Gründen der Bequemlichkeit meist in Geld auszudrücken pflegt, handelt es sich in Wirklichkeit immer nur um Güter eines bestimmten Werts, die der Empfangsberechtigte zu erhalten wünscht, und es kommt oft genug vor, daß man den Zins nicht in Geld, sondern in Naturalien festsetzt, auf dem Lande z.B. in Kartoffeln, Getreide oder Brennholz.
Es bildet also sachlich gar keinen Unterschied, lieber James, ob Du bei Deinem Nachbarn Häuser, Maschinen und Vorräte, oder Aktien und Schuldverschreibungen vorfindest. In dem einen Fall verwaltet der Eigentümer die Gegenstände, die er nach und nach gegen seine Waren und Leistungen eingetauscht hat, selbst, im an dem Fall verwaltet sie ein Dritter für ihn. Auf welche Länder und auf welche Volkskreise Du Deine Untersuchung auch erstreckst, sobald Du auf den Grund gehst, wirst Du stets finden, daß Waren und Leistungen nur in der Absicht hingegeben werden, andere Waren und andere Leistungen dagegen einzutauschen. Die Wirtschaft unserer Tage beruht also, ganz wie die der grauesten Vorzeit, auf dem Tauschverkehr. Sie wirkt nur deshalb etwas kompliziert, weil ein so wirres Durcheinander von Eigentümern, Verwaltern, Darlehnsgebern und Darlehnsnehmern herrscht, die sich die eingetauschten und einzutauschen Güter wie Federbälle zuwerfen; mit anderen Worten, weil sich das Element des Kredits in unserer Zeit so breit macht.
Bei diesem Element müssen wir ein wenig verweilen, mein Junge, denn wir haben es hier mit dem wichtigsten aller Wirtschaftsfaktoren und – um es Dir jetzt schon zu verraten – einem nahen Verwandten des Geldes zu tun. Ich habe eben gesagt, daß der Kredit den modernen Verkehr kompliziert, und daß man ihn daher nicht immer als den Tauschverkehr erkennt, der er in Wirklichkeit ist. Da könntest Du mich nun fragen: Warum schilderst Du mir denn nicht die Verkehrsvorgänge in einem Lande, in dem man den Kredit, diesen vertrackten Störenfried, nicht kennt, und in dem sich daher die Tatsache des Tauschs von Ware gegen Ware unverhüllt in nackter Augenfälligkeit zeigt? Antwort: Weil es ein solches Land nicht gibt und nie gegeben hat. Der Kredit ist genauso alt wie der menschliche Wirtschaftsverkehr und lässt sich nicht aus ihm fortdenken. Nicht einmal in einem Kraal von Menschenfressern, geschweige denn in der zwar vorgeschichtlichen, aber im allgemeinen wohlorganisierten Herdenwirtschaft unseres Erzvaters Abraham kann oder konnte man ohne den Kredit auskommen. Es gibt nur eine einzige Voraussetzung, unter der die Wirtschaft dieses wichtigste aller Hilfsmittel entbehren oder, besser gesagt, so umgestalten kann, daß es nicht mehr als Kredit empfunden wird. Diese Voraussetzung ist – aber ich will nicht vorgreifen.
Ich weiß, mein Lieber, daß Du ein ungläubiger Thomas bist, und vermute daher, daß Du an die Unentbehrlichkeit des Kredits noch nicht so recht glaubst. Stimmt das? Falls es tatsächlich so sein sollte, möchte ich Dich bitten, Dir einmal den Verkehr in einem ganz primitiven Negerstaat Innerafrikas vorzustellen. Die Einwohner dieses Staats müssen von irgendetwas leben, das siehst Du doch ein? Ein Teil der Bevölkerung geht also auf die Jagd, um Fleisch zu beschaffen; ein zweiter Teil treibt Viehzucht der Milch wegen; ein dritter Teil baut Mais, der arbeitsfähige Rest, soweit er nicht zur Leibgarde des Häuptlings gehört, schüttelt Kokosnüsse, schneidet Bambusrohr und Palmblätter zum Hüttenbau oder holt Wasser aus der nahen Oase. Eine noch primitivere Wirtschaftsführung ist wohl kaum denkbar. Nun stelle Dir, Hirte, folgenden alltäglichen Verkehrsakt vor: Ein Viehzüchter, der über nichts anderes als seine Herde Zeburinder verfügt, braucht verschiedene Gegenstände, und zwar einige Palmblätter zum Ausbessern seines Viehstalles, etwas Mais für das tägliche Brot und Wasser für seine Kühe. Wie kommt dieser Kauf zustande? Der nächstliegende Weg, der des glatten Tausches, ist in diesem Falle nicht gangbar, denn jedes Stück Vieh, das der Viehzüchter in Tausch geben kann, ist hundertmal mehr wert als die Palmblätter, der Mais und das Wasser. So viel Palmblätter, Mais und Wasser, wie auf ein Rind kommen, haben die Verkäufer gar nicht vorrätig, und wenn sie es hätten, was sollte wohl der Viehzüchter mit diesen Mengen beginnen? Zum mindesten das Wasser würde schon nach ein paar Tagen verdorben sein. Es bleibt daher den Parteien, wenn sie zum Abschluss kommen wollen, nur der Ausweg übrig, daß eine der anderen den Gegenwert ihrer Leistung stundet. Entweder liefern der Palmensucher, der Wasserträger, der Maisbauer ihr geringes Produkt dem Viehzüchter zunächst ohne Gegenleistung, wobei sich dieser verpflichtet, seinen Bedarf laufend bei ihnen zu decken, und später, wenn die Lieferungen von Palmblättern, Wasser und Mais einen entsprechenden Wert erreicht haben, die ganze Schuld auf einmal durch Hergabe von Rindern abzutragen; oder aber der Viehzüchter liefert dem Palmensucher, dem Wasserträger und dem Maisbauer je ein Rind, wogegen diese sich verpflichten, ihn nach Bedarf mit ihren Produkten zu versehen, und zwar solange, bis der Wert der Produkte den Preis eines Rindes erreicht hat. In beiden Fällen gewährt die eine Partei der anderen – Kredit.
Kredit im täglichen Verkehr zwischen Wilden? Wo es doch selbst im hochentwickelten Rechtsstaat kaum denkbar erscheint, daß im Marktverkehr, der sich aus unzähligen kleinen Käufern und Verkäufern zusammensetzt, jeder Einzelne jedem Einzelnen Kredit gewähren könnte!? Der Einwand liegt sehr nahe, lieber James, das gebe ich ohne weiteres zu. Aber sage mir bitte selbst, wie Du Dir den Warenaustausch in einem primitiven Lande sonst denkst. Tatsache ist doch, daß hier genau wie im Kulturstaat nur höchst selten zwei tauschende Parteien im Besitz absolut gleichwertige Güter sein werden. Tatsache ist ferner, daß selbst in dem seltenen Falle der Wertgleichheit die auszutauschenden Güter nicht in einem und demselben Moment zur Verfügung stehen werden. Soll beispielsweise ein schlachtreifes Schwein gegen eine Tonne Roggen ausgetauscht werden, so kann das Schwein im Winter, der Roggen aber erst im Sommer, nach der Ernte, hergegeben werden. Fast bei jedem Tausch, der zustande kommt, wird somit ein Rest bleiben, der gestundet werden muss, wird also eine Partei der andern Kredit einzuräumen haben. Wo solch Kredit grundsätzlich verweigert wird, kann ein wirtschaftlicher Verkehr nicht aufkommen, gleichviel, ob es sich um einen hochentwickelten Kulturstaat oder um einen primitiven Hottentottenkraal handelt.
Ich sehe hier förmlich, wie Du ärgerlich die Achseln zuckst, um dadurch auszudrücken: Taktisch findet doch aber in der ganzen Welt ein reger Marktverkehr statt, obwohl nirgends die kaufenden oder tauschenden Parteien daran denken, sich gegenseitig Kredit einzuräumen. Irrtum mein Lieber, ein schwerer Irrtum! Du hast Dir den Marktverkehr nicht gründlich genug angesehen. In Wirklichkeit hat sich in der ganzen Welt das Prinzip herausgebildet, dem Käufer einer Ware oder einer Leistung den Gegenwert zu stunden. Du selbst, mein Sohn, nimmst an jedem Tage zehnmal Kredit in Anspruch, freilich ohne es zu wissen, und ohne daß Deine Lieferanten sich dessen bewusst sind. Der Verkehr hat nämlich ein Mittel gefunden, um den Kredit der Verlustgefahr zu entkleiden, die seine allgemeine Anwendung sonst verhindern würde, und zwar auf die einfachste Weise: Jeder Verkäufer lässt sich von jedem Käufer ein Unterpfand bestellen. Weil das bei allen Tauschakten geschieht, und weil es uns daher in Fleisch und Blut übergegangen ist, mit einem Unterpfandezu zahlen und bezahlt zu werden, so sehen wir alle in dem Pfände eine definitive Gegenleistung und sind uns nicht mehr bewusst, daß diese Gegenleistung in Wirklichkeit gestundet, kreditiert worden ist. Wir sehen den Kredit nicht, der in jedem marktmäßigen Verkehrsakt steckt, weil es ein gefahrloser, gedeckter Kredit ist, den wir geben und nehmen, und weil die Deckung immer in einem und demselben Unterpfande besteht.
Es ist nämlich zur Verkehrssitte geworden – und zwar bei den Hottentotten genauso wie bei uns –, ein Normalpfand zu benutzen. Man überlässt es nicht den kaufenden Parteien, sich auf ein x-beliebiges Pfand zu einigen, sondern hat eine bestimmte, allgemein geschätzte, hinreichend vorhandene, leicht teilbare und zusammensetzbare, vor allem aber wertbeständige Ware zum landesüblichen Pfand ausersehen. Dieses Normalpfand, lieber James, nennt man Geld. Die Einführung des Geldes in den Verkehr ist jene vorhin von mir erwähnte einzige Voraussetzung, unter der die Wirtschaft beim Warenaustausch den Kredit zwar nicht entbehren, aber doch so sichern kann, daß er äußerlich nicht mehr als Kredit erscheint.
Ich entsinne mich, früher einmal, mit einem Kollegen, einem jener wenigen Bankdirektoren, die etwas vom Gelde verstehen, darüber gestritten zu haben, ob das Geld wirklich als ein „Pfand“ anzusehen sei. Mein Kollege stimmte zwar mit mir darin überein, daß das Geld an sich keine definitive Gegenleistung für eine verkaufte Ware oder einen geleisteten Dienst, sondern lediglich ein Instrument sei, das den kreditierten Anspruch auf die Gegenleistung sicherstelle. Er meinte aber, das Geld, das diesen Anspruch sichere, sei nicht ein „Pfand“ zu nennen, sondern eher eine „Anweisung“. Denn es verschaffe seinem Inhaber das Recht, Güter in Höhe eines bestimmten Werts aus dem Markte zu nehmen – zu „kaufen“ –, und es weise ihm somit diese Güter an. Daher brauche das Geld durchaus nicht aus einem wertvollen Gut, etwa aus Gold oder Silber zu bestehen. Das sei nur dann nötig, wenn es wirklich als ein vollwertiges Unterpfand von Hand zu Hand gehe, nicht aber, wenn es eine Anweisung auf Güter sei. Denn für eine Anweisung genüge es vollständig, wenn sie von einer Autorität, etwa der Staatsregierung oder einer großen Notenbank, ausgestellt sei. Auf ihren Stoff komme es absolut nicht an; Papier tue genau denselben Dienst wie Gold oder Silber.
Du siehst aus diesem Disput, lieber James, wie wichtig es unter Umständen sein kann, ob man das Geld als eine Pfandsicherheit ansieht, die den mit jedem Verkehrsakt verbundenen Kredit durch ihren Sachwert deckt; oder aber ob man es für eine Anweisung hält, in der irgend eine Stelle den Kredit bescheinigt und dem Kreditgeber das Recht attestiert, Güter entsprechenden Werts zu beziehen. Denn je nachdem man das Geld als ein vollwertiges Sachpfand oder als eine Anweisung der Obrigkeit ansieht, wird man das Metallgeldoder das Papiergeld als eigentliches Geld ansehen. Ich will mich aber heute bei dieser Streitfrage nicht aufhalten, weil es noch wichtigere, prinzipielle Fragen gibt als die, aus welchem Stoff das Geld bestehen muss. Du wirst das deutlich erkennen, wenn wir um einige Briefe weiter sein werden. Einstweilen brauchst Du Dir also den Kopf nicht darüber zu zerbrechen, ob Du im Gelde wirklich ein Unterpfand für gewährten Kredit zu erblicken hast. Unbedingt festhalten musst Du dagegen an folgenden Leitsätzen:
Im wirtschaftlichen Verkehr wird stets und ausnahmslos die eine Leistung gegen die andere getauscht. Dabei erfolgt aber nur die eine Leistung in der Gegenwart. Die andere erfolgt erst in der Zukunft. Bis zu diesem künftigen Zeitpunkt besteht ein Kreditverhältnis, nämlich ein Anspruch der einen Partei (des Verkäufers) auf die noch ausstehende Gegenleistung der anderen Partei (des Käufers). Dieser Anspruch wird durch ein Verkehrsinstrument gesichert, das man „Geld“ nennt. Das Geld tritt – gleichviel ob als Pfand oder als Anweisung – provisorisch an die Stelle der noch ausstehenden Gegenleistung. Es wird daher meist selbst als die Gegenleistung angesehen. Wie das Geld beschaffen ist, und wer es ausgegeben hat, ist grundsätzlich ohne jeden Belang. Es kommt nur auf eins an, und zwar darauf, daß das Geld seine Aufgabe, einen Güteranspruch sicherzustellen, vollkommen erfüllt. Tut es das, so ist es gutes, vollwertiges Geld, auch wenn es aus billigem Papier besteht. Erfüllt es die Aufgabe nicht, so daß der Inhaber seinen wohlerworbenen Güteranspruch ganz oder teilweise einbüßt, so ist es minderwertiges Geld, auch wenn es aus Metall hergestellt und von der höchsten Autorität im Staate auf Grund der geltenden Gesetze ausgegeben worden ist. Soviel für heute.
In Liebe
Dein alter Papa.
3. Brief
Das Geld ein Recht – Gibt es „zu wenig Geld“? – Der Staat und das Geld
Berlin, am 5. Januar 1921.
Einen Satz, mein lieber James, kannst Du Dir gar nicht fest genug in Deinen Verstand hämmern. Der Satz, der die Quintessenz meines vorigen Briefes ausmacht, lautet: „Geld ist die Verkörperung eines Güteranspruchs, der dadurch entstanden ist, daß jemand etwas geleistet, die Gegenleistung aber noch nicht erhalten hat.“ Oder kürzer: „Geld verkörpert den aus einer Leistung entstandenen Anspruch auf gleichwertige Gegenleistung.“ Dieser Satz ist das A und O der ganzen Geldlehre. Aus ihm ergibt sich alles, was über das Geld zu sagen ist, eigentlich von selbst. Würden nur alle Völker sich diesen harmlosen Satz einprägen und niemals gegen seinen Sinn verstoßen, so würde es in der ganzen Welt kein Geldelend und keine Valutafrage geben.
Sobald der Anspruch auf Gegenleistung, den jeder marktmäßige Güteraustausch zur Folge hat, durch das Geld gesichert wird, geht mit ihm eine äußerliche Veränderung vor sich. Du erkennst das sofort, wenn Du Dir einen konkreten Fall vorstellst. Denke Dir einen Arbeiter, der für 200 Mark Arbeit geleistet, das heißt, sich einen Anspruch auf Güter im Werte von 200 Mark erworben hat. Er hat diesen Anspruch bis zum Zahltage ausschließlich gegen seine Arbeitgeber. (Bis zum Zahltage gewährt jeder Arbeiter seinem Arbeitgeber „Kredit“). In dem Moment aber, wo dieser dem Arbeiter die 200 Mark auszahlt, fällt der Anspruch gegen ihn selbst fort. Die Beiden sind „quitt“. Dadurch ist aber nicht etwa auch der Anspruch an sich erloschen, vielmehr bleibt derselbe, im Gelde verkörpert, in der unveränderten Höhe von 200 Mark bestehen. Nur richtet sich der Anspruch jetzt nicht mehr gegen einen Einzelnen, den Arbeitgeber, sondern gegen die Gesamtheit, den Markt. Der Arbeiter kann die ihm für seine Arbeit zugesicherte Gegenleistung nunmehr einkassieren, wo und in welcher Form er will. Er kann sich beim Schuster ein Paar Stiefel, beim Kaufmann Lebensmittel und Zigarren, beim Gastwirt Bier kaufen. Erst wenn er das getan und seine 200 Mark ausgegeben hat, ist sein Güteranspruch erloschen. Dann erst ist der Zweck des Tausches erfüllt, den der Arbeiter mit seinem Arbeitgeber vorgenommen hat: er hat für seine Arbeitsleistung Stiefel, Lebensmittel, Zigarren und Bier eingetauscht. Der Empfang des Geldes war nur eine Zwischenstufe, die notwendig war, weil der Arbeitgeber die Waren, die der Arbeiter zu erhalten wünschte, nicht selbst hatte, weil es mithin einer Garantie bedurfte, daß der Arbeiter die durch seine Hände Arbeit verdienten Waren auch wirklich irgendwo erhielt.
Halte das recht fest, mein Sohn: Solange jemand für eine Leistung keinerlei Gegenwert, auch nicht in der Interimsform von Geld erhalten hat, besitzt er lediglich einen Anspruch an eine bestimmte Person, nämlich eine Forderung an den Empfänger seiner Leistung. Unser Arbeiter beispielsweise hat zunächst eine Forderung in Höhe von 200 Mark einzig und allein an seinen Arbeitgeber. Sobald aber derselbe Jemand Geld für seine Leistung erhalten hat, besitzt er eine Forderung an die Allgemeinheit. Unser Arbeiter hat jetzt einen Anspruch an den Markt, der ihm Stiefel, Lebensmittel, Bier, oder was der Arbeiter sich sonst aussuchen mag, bis zum Werte von 200 Mark liefern muss. Im ersteren Fall, d.h. solange der Leistende noch einen Anspruch an eine einzelne Person oder ein Guthaben bei dieser Person hat, nennt der Sprachgebrauch das Verhältnis zwischen den beiden Parteien ein Kreditverhältnis. Im zweiten Fall, wenn also der Leistende Geld erhalten hat, spricht man, obwohl sich in der Sache selbst eigentlich nichts geändert hat, nicht mehr von Kredit, sondern von Kaufkraft. Man sagt, der Geldempfänger könne am Markt eine so große Kaufkraft ausüben, wie in dem empfangenen Geldbetrag ausgedrückt ist. Streng genommen besteht aber auch jetzt noch ein Kreditverhältnis. Der Geldempfänger hat nach wie vor seine Forderung, nur daß er diese Forderung nicht mehr gegen eine einzelne Person, sondern gegen die Gesamtheit hat, die den „Markt“ ausmacht.
Wir sind jetzt so weit, lieber James, daß wir wissen, was das Geld seinem Wesen nach darstellt, und welches seine wichtigste Funktion ist. Um es kurz zu rekapitulieren: Das Geld stellt ein attestiertes Recht zum Bezuge von Gegenleistungen dar, denen entsprechende Leistungen vorangegangen sind, und seine Hauptfunktion besteht darin, diese Gegenleistungen von dem „Markt“ auf den Empfangsberechtigten zu übertragen. Aber damit sind wir noch immer sehr weit vom Ziel. Wir stehen noch vor einer ganzen Reihe ungelöster Fragen. Und zwar drängen sich uns vor allem drei Fragen auf. Erstens: Wie viel Geld, wie viel Kaufkraft muss in einem Lande existieren? Zweitens: Wie viel Marktware erhält man für das einzelne Geldzeichen, das heißt, welchen Wert hat das Geld? Und drittens: Wie entsteht das Geld? Im Grunde beantworten alle diese Fragen sich von selbst, sobald man im Gelde nur das sieht, was es ist, nämlich ein Bezugsrecht, und immer daran denkt, daß sich in ihm eine aufgeschobene Gegenleistung verkörpert. Da aber die menschliche Logik gern Seitensprünge macht, und jedes Abweichen vom geraden Wege hier unfehlbar zum Irrtum führt, so muss ich Dir beim Auffinden der eigentlich selbstverständlichen Antworten ein wenig helfen.
Also erstens: Wie viel Geld muss in einem Lande umlaufen? Hierüber sind bei den Volkswirten die merkwürdigsten Ansichten verbreitet. Die meisten von ihnen glauben, daß die Geldmenge in einem ganz bestimmten Verhältnis zur Güterproduktion stehen müsse, und daß daher mit zunehmender Produktion auch mehr Geld in Umlauf zu setzen sei; geschehe das nicht, so entstehe „Geldmangel“. Diese Auffassung, wie überhaupt jede Auffassung, die im Gelde einen planmäßig zu vermehrenden oder zu vermindernden Artikel sieht, ist grundfalsch. Sie ist genauso unsinnig, wie es etwa die Ansicht sein würde, man brauche nur die Eintragungen in die Grundbuchblätter und Häuser-Kataster im Lande zu vermehren, um die Wohnungsnot zu beseitigen. Man ist wohl imstande, greifbare Gegenstände, also Häuser und Wohnungen zu vermehren oder zu vermindern. Aber man kann kein abstraktes Recht verdoppeln oder halbieren. Und das Geld ist nichts anderes als ein attestiertes Recht. Es ist – man kann das gar nicht oft genug wiederholen – das Recht auf eine Gegenleistung, das sich jemand dadurch erwirbt, daß er seine eigene Leistung hingibt. Für den Arbeiter, der seine Arbeitsleistung zum vereinbarten Preise von 200 Mark hingegeben hat, bedeutet das Geld, das er dafür empfängt, nichts anderes als das Recht, sich den vereinbarten Gegenwert durch Einkäufen von Stiefeln, Lebensmitteln, Bier usw. zu beschaffen. Seine 200 Mark entsprechen genau der Gütermenge, auf die er sich durch seine Arbeit ein Anrecht erworben hat. Mit jedem Einkauf, den er macht, verringert sich sein Geldbestand, d.h. sein Anrecht auf Güter. Denn in der Höhe seines Einkaufs erhält er für seine Arbeitsleistung die entsprechende definitive Gegenleistung, wofür er natürlich die provisorischeGegenleistung, nämlich das im Geld verkörperte Recht zum Güterbezug, hergeben muss; genau wie Du im Theater Deine Garderobenmarke, Dein Recht zur Abhebung eines Mantels und eines Huts, in dem Moment einbüßest, wo Du die Sachen in Empfang nimmst.
Jeder Mensch, der einen Tauschakt vorgenommen, den Gegenwert, auf den er es abgesehen hat, aber noch nicht erhalten hat, besitzt Geld, das heißt ein beglaubigtes Recht zur Erhebung des Gegenwerts in natura. Und jedes Geldzeichen, das im Lande existiert, bedeutet, daß irgendjemand einen Gegenwert, auf den er einen Anspruch besitzt, noch nicht in Empfang genommen hat. Daher kann es eigentlich nie „zu viel“ und nie „zu wenig“ Geld geben. Es läuft immer genau so viel Geld in einem Lande um, wie Tauschakte zwar vorgenommen, aber nicht vollständig erledigt, sondern sozusagen noch in der Schwebe geblieben sind. Denn das Geld ist ja gerade die Bescheinigung, daß ein Tauschakt erst zur Hälfte durchgeführt worden ist, weil der zum Empfang der Gegenleistung Berechtigte diese noch nicht in Händen hat; es ist zugleich das Rechtsdokument, das seinen Inhaber zum Bezuge der Gegenleistung legitimiert. Da somit die Geldmenge im Lande immer genau so groß sein muss, wie die Summe aller noch nicht in Anspruch genommenen Gegenleistungen, so vermag ich beim besten Willen nicht einzusehen, wie man die Geldmenge von Staats wegen vergrößern oder verkleinern kann. Jedes willkürlich neugeschaffene Geldzeichen bedeutet ja einen Rechtstitel zum Bezuge einer Gegenleistung, obwohl niemals eine Leistung stattgefunden hat, die sie rechtfertigt. Es bescheinigt einen in der Schwebe gelassenen Tauschakt, der in Wirklichkeit gar nicht vorgenommen worden ist, und ist daher gewissermaßen eine Fälschung. Umgekehrt bedeutet jede willkürliche Verringerung des Geldumlaufs, jede Vernichtung von Geldzeichen, eine Annullierung von wohlerworbenen Rechten auf Gegenleistung und somit einen Gewaltakt.
Ich möchte fast mit Dir wetten, lieber James, daß ich den Einwurf kenne, den Du hier machen willst. „Wenn der Staat neues Geld schafft, so ermöglicht er dadurch eine große Zahl neuer Tauschakte. Tausende, die vorher nicht kaufen konnten, können es jetzt. Es entsteht eine Nachfrage am Markt, welche die Erzeuger zwingt, mehr Güter herzustellen, welche also die nationale Produktion hebt. Der vermehrten Geldmenge steht alsdann eine vermehrte Gütermenge gegenüber, so daß der im neuen Geld verkörperte Anspruch vollauf befriedigt werden kann.“ Habe ich Recht? Ist das nicht Dein Gedankengang? Wenn nicht, so ist es doch die landläufige Argumentation, und da sie außerordentlich bestechend klingt, werde ich mich wohl oder übel mit ihr auseinandersetzen müssen.
Machen wir uns die Sache einmal an einem praktischen Beispiel klar: Ein Staat, in dem eine Million Geldzeichen zirkuliert, gibt aus irgendwelchen Gründen eine weitere Million aus. Er stellt also Anrechtsscheine aus, die genau wie die bereits umlaufenden Geldzeichen zum Bezuge von Gütern berechtigen. Frage: zum Bezuge welcher Güter? Antwort: zum Bezuge aller Gattungen; es steht völlig im Belieben der Empfänger des neuen Geldes, welche Güter sie auf dem Markt damit kaufen wollen. Wir stehen also vor der Tatsache, daß ein bestimmtes Quantum von Marktgütern, das bis dahin noch keine Veränderung erfahren hat, plötzlich einer doppelt so großen Nachfrage gegenübersteht, weil die alten unddie neuen Geldzeichen das in ihnen verkörperte Bezugsrecht geltend machen. Es entsteht gewissermaßen eine Konkurrenz um die Güter. Das muss natürlich seine Folgen haben. Es ist eine alte, noch niemals bestrittene Erfahrungstatsache, daß bei doppelter Nachfrage und gleichbleibendem Angebot die Preise der Waren steigen. Die Verdoppelung der Geldzeichen führt also dazu, daß die Marktgüter teurer werden. Wie groß der Preisaufschlag ist, das bildet eine wissenschaftliche Streitfrage. Wir wollen der Einfachheit halber annehmen, daß die verdoppelte Nachfrage zu einem verdoppelten Preis führt. Das Resultat der Geldvermehrung ist mithin, daß jeder Inhaber alten Geldes bei seinen Einkäufen das Doppelte bezahlen muss wie früher.
Hier höre ich wieder einen Zwischenruf: „Das stimmt nicht! Die neue Nachfrage reizt durch die steigenden Preise ja die ganze Produktion zu erhöhter Tätigkeit. Infolgedessen erscheinen sehr bald neue Gütermengen am Markt, die der verstärkten Nachfrage ein verstärktes Angebot gegenüberstellen und die steigenden Preise wieder herunterdrücken.“ Der Zwischenruf ist nicht ganz unberechtigt. Es kann in der Tat diese Wirkung eintreten, nämlich dann, wenn die Fabrikanten und ihre Arbeiter sich durch die Preissteigerung zu einer verstärkten Arbeitsleistung anregen lassen. Aber diese Wirkung muss nicht eintreten. Vergegenwärtige Dir, daß die steigenden Preise zu wesentlich erhöhten Gewinnen führen, daß die reichlicheren Gewinne höhere Löhne zur Folge haben, und daß so in der ganzen Produktion eine Leichtigkeit des Verdienens entsteht, die sehr oft nicht zu vermehrter Arbeit, sondern zum Gegenteil, zu einer gewissen Bequemlichkeit und Trägheit reizt. In solchen Zeiten hegt oft der Ruf nach dem Sieben- oder Sechsstundentag in der Luft. Es kann also sehr leicht ein Rückgang statt einer Steigerung der Gütererzeugung eintreten. Aber selbst wenn die Produktion wirklich steigt und das Angebot wächst, ist das doch immer nur die allmählich und zögernd wirkende Folge der sofort und ungestüm auftretenden Preissteigerung. Das erste und sichere Moment ist immer die Teuerung; die Verbilligung ist eine spätere und sehr fragliche Eventualität, die überdies im besten Fall die Teuerung etwas mildert, sie aber niemals ganz verhindert. Wir müssen uns also schon mit der Tatsache abfinden, daß die Geldvermehrung die Preise steigert, und die einzige Konzession, die ich Dir allenfalls machen kann, ist die, daß wir die Steigerung als nicht ganz so stürmisch voraussetzen, wie ich es oben getan habe. Nehmen wir also in Gottes Namen an, daß eine 100 prozentige Geldvermehrung eine nur 50 prozentige Preissteigerung zur Folge hat.
Was heißt es aber, lieber James, wenn alle Inhaber alten Geldes bei jedem Einkauf 50 Prozent mehr bezahlen müssen als früher? Was heißt es, wenn, um bei unserem Beispiel zu bleiben, der Arbeiter für seine 200 Mark nicht mehr wie früher Stiefel, Lebensmittel, Zigarren und Bier erhält, sondern etwa nur noch Lebensmittel und Zigarren, so daß er auf Stiefel und Bier verzichten muss? Das heißt nichts anderes, als daß man ihm durch die Geldvermehrung einen Teil der Gegenleistung, die er sich mit seiner Arbeit verdient hat, gewaltsam genommen, daß man ihn bis zu einem gewissen Grade enteignet hat. Natürlich wird er versuchen, sich schadlos zu halten, indem er seinen Arbeitstarif erhöht und nunmehr 300 Mark Lohn verlangt, das heißt Anspruch auf so viel Bezugsrechte erhebt, wie nötig sind, um dieselben Gütermengen wie früher beziehen zu können. Nur selten aber gelingt ihm dies in vollem Maße. Und wenn es ihm gelingt, so geschieht es auf Kosten anderer Bevölkerungsklassen, etwa der Beamten, der Staatspensionäre, der Rentner. Denn die Tatsache ist nicht aus der Welt zu schaffen, daß die 1 Million neuer Geldzeichen, die der Staat geschaffen hat, auf Gütermengen Beschlag legen, in die sich bis dahin die Million alter Geldzeichen geteilt hat. Irgendwelche Volksklassen müssen da notwendigerweise die Kosten tragen und es sich gefallen lassen, daß ihr wohlerworbener Anspruch auf Gegenleistung um ein Drittel oder mehr zusammenschrumpft.
Das soll und darf aber nicht sein, mein Sohn! Das Geld ist ein Recht und soll kein Unrecht werden. Darum darf der Staat sich niemals die Freiheit herausnehmen, Geld nach Willkür schaffen oder vernichten zu wollen, denn er schafft oder vernichtet damit wohlerworbene Ansprüche auf Güter. Es ist ein eigen Ding um die Allmacht des Staats auf dem Gebiet des Geldwesens. Es ist eine Allmacht, die der Ohnmacht so ähnlich sieht, wie ein Ei dem anderen. Wenn Du nämlich dem, was ich eben ausgeführt habe, tiefer auf den Grund gehst, so wirst Du eine höchst merkwürdige Entdeckung machen, und es tut mir nur leid, daß ich Dein erstauntes Gesicht nicht sehen kann, wenn Du sie machst. Oder ist es keine überraschende Entdeckung, daß der Staat gar kein Geld schaffen kann, auch wenn er sich noch so große Mühe gibt? Es ist aber in der Tat so. Aber, was der Staat vermag, erschöpft sich darin, mechanisch neue Geldzeichen herzustellen. Aber diese Geldzeichen erfüllen nicht den Zweck, den das Geld hat; sie stellen dem Volke keine neuen Bezugsrechte auf Güter zur Verfügung, sie machen das Volk nicht um ein Jota kaufkräftiger, sondern sie übertragen nur längst bestehende Bezugsrechte, längst vorhandene Kaufkraft von ihren rechtmäßigen Eigentümern auf andere Leute. Sie schöpfen von dem Recht zum Güterbezug, das der Volksgemeinschaft gehört und ihr im alten Gelde verbrieft ist, einen bestimmten Teil ab und verleihen diesen Teil den Inhabern der neu ausgegebenen Geldzeichen. Indem der Staat solche Geldzeichen herstellt, gibt er dem Einen nur, was er dem Andern nimmt. Irgendetwas Neues vermag er auf diesem Wege nicht entstehen zu lassen. Auf eine knappe Formel gebracht: Der Staat schafft, indem er Geldzeichen ausgibt, kein neues Geld, sondern er besteuert den einen Teil der Bevölkerung zu Gunsten des anderen.
So liegen die Dinge, lieber James. Es ist nur eine Augentäuschung, wenn Du angesichts der Berge von Zettelgeld, in denen wir zu ersticken drohen, glaubst, das Deutsche Reich habe in den letzten Jahren mit Hilfe der Reichsbank 70 Milliarden Mark neues Geld geschaffen. Freilich, die Zettel sind da, daran ist nicht zu zweifeln. Aber sie sind kein neues Geld. Die Kaufkraft, die ihnen innewohnt, ist noch nicht einmal so groß wie die Kaufkraft der vier oder fünf Milliarden Mark Münzen und Noten, die 1914 in Deutschland umgelaufen sind. Und selbst das bisschen Kaufkraft, das sie wirklich repräsentieren, rührt nicht etwa vom Staate her, ist ihnen nicht durch die schöpferische Kraft der Regierung neu eingeblasen worden, sondern ist dieselbe Kaufkraft, die früher in den vier oder fünf Milliarden alten Geldes steckte und von Rechts wegen den Inhabern dieser wenigen Milliarden gehört. Daß man den weitaus größten Teil der Kaufkraft von dem alten Gelde zwangsweise auf neue Produkte der Notenpresse übertragen und diesen künstlich einen Wert verliehen hat, kann man nur euphemistisch als „Geldpolitik“ bezeichnen. Richtiger ausgedrückt ist es ein brutaler Akt von Enteignung. Und das einzige, was der Staat dem Gelde gegenüber vermag. Er kann Geld, das heißt Güterbezugsrechte, immer nur enteignen, niemals neu schaffen.
Daß der Staat nicht imstande ist, Geld zu schaffen, wenn er es für nötig hält, schadet aber absolut nichts. Denn Geld ist ja kein Selbstzweck, sondern nur ein Mittel zum Zweck der Verkehrserleichterung, und es ist in jedem Lande, in dem der Staat keine Torheiten macht, immer genau so viel Geld vorhanden, wie für diesen Zweck nötig ist. Das Geldwesen regelt sich automatisch, und der Staat hat weiter nichts zu tun, als den Geldautomaten technisch in Ordnung zu halten. Für schöpferische Betätigung ist hier kein Platz, und es ist ein verhängnisvoller In turn, wenn zahlreiche Volkswirte glauben, das Geld sei ein Geschöpf der staatlichen Rechtsordnung.
Wessen Geschöpf das Geld nun aber in Wirklichkeit ist? Hab einige Tage Geduld, mein Sohn, und Du wirst es wissen. Für heute weigert sich meine Feder, ihren Dienst weiter zu verrichten.
In Liebe
Dein sehr ermüdeter Papa.
4. Brief
Hat das Geld einen Eigenwert? – Wirkliches Geld und Scheingeld.
Berlin, am 8. Januar 1921.
Über zwei Dinge, hoffe ich, bist Du Dir heute im klaren, lieber James. Erstens darüber, daß jedes Geldzeichen ein Recht, und zwar ein beglaubigtes Bezugsrecht, darstellt; zweitens darüber, daß die Mengedieser Rechte, die Menge des umlaufenden Geldes, nie zu groß und nie zu klein ist, sondern immer gerade dem Bedarf entspricht. Wie groß dieser Bedarf ist, und welche absolute Geldmenge infolgedessen im Lande umläuft, das werden wir in einigen Tagen sehen, nämlich, wenn wir uns der interessanten Frage zuwenden, wie das Geld entsteht. Bis dahin müssen wir manches noch auf sich beruhen lassen; so z.B. auch die eigentümliche Erscheinung, daß es in jedem Lande und zu jeder Zeit so aussieht, als ob bei weitem zu wenig Geld vorhanden wäre, und zwar ganz gleichgültig, ob in dem Lande 1 Million oder 100 Milliarden Geldzeichen im Umlauf sind. Ich weiß sehr wohl, daß diese universelle Erscheinung Dich stutzig macht, obwohl Du ahnst, daß irgend ein Irrtum dahinter steckt. Aber wir können nicht alle Details auf einmal behandeln, sondern müssen immer hübsch eins nach dem anderen vornehmen. Sind erst die Hauptfragen aufgeklärt, so verschwindet mancher Irrtum in den Einzelheiten ganz von selbst.
Die erste Hauptfrage war die nach der Menge des Geldes; mein letzter Brief hat sie in großen Umrissen behandelt, und wir können uns nunmehr der zweiten Hauptfrage zuwenden: Welchen Wert hat das Geld?
Mit dieser Frage müsstest Du eigentlich schon ganz allein fertig werden können. Denn sobald Du Dir vergegenwärtigst daß das Geld weiter nichts ist als ein attestiertes Recht, ein Recht zum Bezuge von Gütern, musst Du ohne weiteres erkennen, daß die Fragestellung an sich sinnlos ist. Ein abstraktes „Recht“ kann niemals einen konkreten „Wert“ haben. Es kann wohl den Wert, den irgend eine Sache hat, von einer Person auf die andere übertragen, es kann die Besitzverhältnisse an diesem Werte regeln, aber es kann den Wert nicht in sich selbst verkörpern. Du darfst Dich nicht dadurch irre machen lassen, daß es Geld einer bestimmten Art gibt, welches tatsächlich ungefähr den konkreten Wert hat, den es attestiert, daß also z.B. ein englischer Sovereign und eine deutsche Doppelkrone nicht nur ein Bezugsrecht im Werte von 20 Schilling und 20 Mark darstellen, sondern diesen Wert kraft ihrer körperlichen Beschaffenheit, weil sie nämlich aus Gold bestehen, auch wirklich haben. In diesem Falle ist es nicht das Geld, nicht das Güterbezugsrecht, das einen Eigenwert hat, sondern nur das Metall, auf dem (durch Prägung) das Bezugsrecht bescheinigt ist. Solltest Du zufällig eine Doppelkrone aus der Vorkriegszeit in unsere papierne Gegenwart hinübergerettet haben, so kannst Du sofort die Probe auf das Exempel machen, indem Du das Goldstück einschmelzen lässt. Obwohl das Gold nunmehr keine Doppelkrone, kein Geld mehr ist, hat es doch denselben Wert wie früher, nämlich 20 Goldmark oder 4 3/4 Dollar. Die papiernen Zwanzigmarkscheine dagegen, die Du etwa noch aus der Vorkriegszeit liegen hast, sind tief, tief unter diesen Wert gesunken. Würde das Geld seinen Wert wirklich aus sich selbst, aus seiner Eigenschaft als Geld herleiten, so müssten die beiden Geldzeichen, die eins wie das andere 20 Mark darstellen, genau den gleichen Wert haben. Tatsächlich hat sich nur die Doppelkrone ihren alten Wert von 20 Goldmark = 4 3/4 Dollar erhalten, und zwar deshalb, weil sie seit jeher noch etwas anderes als Geld gewesen ist, nämlich Gold, d.h. eine Ware von ganz besonderer Wertbeständigkeit.
Wir müssen also die Frage anders fassen, mein Lieber. Wir haben nicht zu fragen: „Welchen Wert hat das Geld?“ Sondern: „Wie groß ist der Güteranspruch, den das Geld gewährleistet?“
So gestellt, beantwortet sich die Frage aber von selbst. Denn wie lautet der Fundamentalsatz, den Du Dir einzuprägen hast, wenn Du meinen väterlichen Zorn und dauernde Unkenntnis in Punkto Geldwesen vermeiden willst? Er lautet: „Geld verkörpert den aus einer Leistung entstandenen Anspruch auf gleichwertige Gegenleistung.“ Daraus ergibt sich ohne weiteres, daß der Güteranspruch, den das Geld gewährleistet, bzw. der ideelle Wert, den es deshalb für seinen Eigentümer hat, genau so groß ist, wie der Wert der vorausgegangenen Leistung.
Das klingt Dir vielleicht so, als ob es im Grunde gar nichts besagt, sondern nur ein Spiel mit Worten ist. Denn wir kennen den Wert der vorangegangenen Leistung genau so wenig wie den Wert der folgenden Gegenleistung. Tatsächlich handelt es sich hier aber um eine sehr, sehr wichtige Feststellung, die uns zu einer Erkenntnis von außerordentlicher Tragweite führt. Wenn es nämlich richtig ist, daß der „Wert des Geldes“ – wir wollen der Kürze halber bei diesem nicht ganz korrekten Ausdruck bleiben – dem „Wert der Leistung“ gleichkommt, für die es sein Inhaber erhalten hat, so folgt daraus nicht weniger, als daß es heute fast in ganz Europa – kein Geld mehr gibt.
Ich bitte Dich dringend, mein Lieber, dies nicht etwas als einen Scherz aufzufassen. So sehr es Dich auch verblüffen mag, es ist in der Tat buchstäblich wahr, daß heute nur noch in sehr wenig Ländern richtiges, echtes Geld existiert, das heißt ein Zahlungsmittel, das die erste und wichtigste Aufgabe des Geldes erfüllt, die darin besteht, den vollen Wert der Leistung bis zum Bezuge der Gegenleistung zu konservieren, ihn gewissermaßen in der Gegenleistung auferstehen zu lassen. Das Geld, das Du heute nicht nur in Deutschland, sondern auch in Ländern mit verhältnismäßig guter Währung, wie England, Holland, der Schweiz, umlaufen siehst, erfüllt zwar viele Aufgaben, die das echte Geld erfüllt, aber es versagt in der Hauptsache. Es bietet seinem Inhaber nicht die Gewähr, daß er für eine Ware, die er geliefert, oder eine Leistung, die er vollbracht hat, wirklich den vereinbarten Gegenwert erhält. Denke zum Beispiel an den Arbeiter, den ich in meinem vorigen Briefe einige Mal erwähnt habe. Als er vor drei Jahren 200 Mark für seine Arbeit erhielt, da erhielt er den Wert von einem Paar Stiefel sowie von Lebensmitteln, Zigarren und Bier für den Bedarf von etwa zwei Wochen. In dem Bewusstsein, die 200 Mark jederzeit in diese Waren Umtauschen zu können, hat er sich für seine Arbeit ein Entgelt in diesem und keinem höheren Werte ausbedungen. Wenn er nun mit der Beschaffung der Sachen gewartet und das Geld aufbewahrt („gespart“) hat, um sich erst heute in den Besitz all der Güter zu setzen, für die er vor drei Jahren seine Leistung hingegeben hat, so sieht er mit Befremden, daß die Güter für ihn nicht mehr erreichbar sind. Er erhält für sein Geld im besten Falle ein Paar Stiefel.[1] Um die Lebensmittel, die Zigarren, das Bier ist er geprellt. „Das Geld hat keinen Wert mehr“, sagt er bitter, und er meint damit, daß das Geld seine Bestimmung, ihm den vollen Wert seiner Leistung bis zu dem Tage zu sichern, an dem er die Gegenleistung beansprucht, nicht erfüllt hat. Ein Geld aber, daß diese Bestimmung nicht erfüllt, sondern den in ihm verkörperten Anspruch zusammenschrumpfen lässt, ist kein echtes Geld, sondern eine unvollkommene Imitation. Und mit solchen Imitationen ist heute ganz Europa überschwemmt. Die Nachahmungen sind ja nicht überall so schlecht wie in Deutschland, Österreich oder gar Russland, wo sie den in ihnen verkörperten Anspruch auf ein Zehntel, ein Fünfzigstel oder ein Tausendstel haben zusammenschmelzen lassen. Aber auch in England, der Schweiz, Holland usw., wo der Anspruch noch die Hälfte bis drei Viertel seiner ursprünglichen Höhe beträgt, ist das Geld das ihn derart reduziert hat, kein wirkliches Geld, sondern Scheingeld.
Echtes Geld ist nur ein solches, das seinem Inhaber den aus einer Leistung entstandenen Anspruch auf Gegenleistung ungeschmälert erhält. Denn seinem Zweck und Wesen nach ist das Geld nichts anderes als ein Rechtsanspruch. Daß es daneben noch eine Reihe anderer Funktionen erfüllt, z.B. den Rechtsanspruch von Hand zu Hand gehen lässt, fällt neben dem Hauptzweck nicht ins Gewicht, und sobald es diesen nicht oder nur mangelhaft erfüllt, ist es kein Geld mehr, so gut es auch etwa die anderen Funktionen noch erfüllen mag.
Also rekapitulieren wir, lieber James. Da Geld ein Anspruch auf Gegenleistung ist, so ist sein „Wert“ genau so groß wie diese. Und da es seine erste und wichtigste Aufgabe ist, dafür zu sorgen, daß die Gegenleistung ihrerseits so groß ist wie die vorangegangene Leistung, so ist der „Wert“ des Geldes auch genau so groß wie diese Leistung.
„Soweit dies zutrifft, ist es im Grunde eine Selbstverständlichkeit“, wirst Du hier vielleicht einwerfen. „Außerdem scheint es mir aber nicht einmal ganz richtig zu sein. Die Stiefel und Lebensmittel zum Beispiel, auf die unser mehrfach erwähnter Arbeiter einen Anspruch hat, können infolge einer Lederknappheit oder einer Missernte knapp und teuer werden. In diesem Falle geht dem Arbeiter ein Teil seines Anspruchs verloren. Das Geld, das den Anspruch verkörpert, reicht dann nur noch für Lebensmittel, Zigarren und Bier, aber nicht mehr für Stiefel aus. Es entspricht also einer Gegenleistung, die kleiner ist als die ursprüngliche Leistung, während es den Wert derselben doch gerade sichern sollte. Also ist auch wirkliches Geld nicht im Stande, einen Güteranspruch für die Dauer voll zu gewährleisten.“
Ich beginne mit dem zweiten Einwand, der mir Gelegenheit gibt, mich in einem wichtigen Punkt zu berichtigen. Wenn ich gesagt habe, der Arbeitgeber bezahle den Arbeiter für seine Leistung in der Weise, daß er ihm – durch Hingabe von 200 Mark – einen Anspruch auf Stiefel, Lebensmittel, Zigarren und Bier gewährleiste, so ist das, wie ich ohne weiteres zugebe, nicht ganz korrekt. Ich habe den Vorgang nur der Anschaulichkeit wegen so scharf präzisiert. In Wirklichkeit stellen die 200 Mark des Arbeitgebers keine Garantie dafür dar, daß die Gegenstände, die im Moment der Leistung für 200 Mark erhältlich sind, in alle Ewigkeit dafür zu haben sein werden. Das Geld sichert den Anspruch auf Gegenleistung immer nur innerhalb eines bestimmten Rahmens. Indem der Arbeitgeber 200 Mark hergibt, überlässt er dem Arbeiter einen ganz bestimmten Teil der in diesem Augenblick im Lande vorhandenen Ansprüche auf Güter, sagen wir ein Millionstel aller Ansprüche. Dieses Millionstel bedeutet heute ein Paar Stiefel und ein bestimmtes Quantum Lebensmittel, Zigarren und Bier, kann aber morgen bereits mehr oder weniger bedeuten. Das hängt ganz von der größeren oder geringeren Erzeugungsfähigkeit im Lande ab, die unter anderem auch von elementaren Ursachen bestimmt wird. Gegen derartige Schwankungen kann auch das wirkliche Geld, das den Namen „Geld“ verdient, den Güteranspruch nicht schützen. Es kann beispielsweise nicht verhindern, daß eine Erfindung gemacht wird, die es gestattet, einen Stiefel in einem Zehntel der jetzigen Arbeitszeit herzustellen, so daß der Arbeiter statt des einen Paares Stiefel, auf das ihm seine Leistung Anspruch gibt, eines Tages deren zwei oder drei beziehen kann. Dieses Moment der Unsicherheit tritt aber weit zurück gegenüber der Gewähr, die das Geld wirklich leistet, und die darin besteht, daß es seinem Inhaber dauernd einen festbestimmten Teil aller im Lande existierenden Güteransprüche sichert. Unser Arbeiter hat zwar keinen Anspruch auf eine bestimmte Menge Stiefel, Lebensmittel usw., aber er hat einen Anspruch auf ein Millionstel des Gesamtanspruchs im Lande. Wenn auch dieses Millionstel bald einem größeren, bald einem geringeren Güterquantum entspricht, so pflegen doch diese Mengenschwankungen so gering zu sein und sich im Laufe der Zeit so auszugleichen, daß man ihnen in der Praxis kaum Rechnung trägt, auch wenn es sich um Abmachungen auf 50 oder 100 Jahre handelt. Aber wohlgemerkt nur da, wo wirkliches, echtes Geld umläuft. Denn nur dieses Geld sichert seinem Inhaber den ihm zustehenden Teilanspruch, verbürgt also, um bei unserem Beispiel zu bleiben, dem Arbeiter, daß er Besitzer eines Millionstel aller Güteransprüche ist und bleibt. Das Scheingeld, das wir jetzt in fast allen Ländern umlaufen sehen, leistet diese Bürgschaft nicht, sondern vermehrt die Güteransprüche so willkürlich, daß unser Arbeiter schon nach kurzer Zeit nicht mehr ein Millionstel, sondern je nach dem Grade der Willkür nur noch ein Zehnmillionstel oder ein Hundertmillionstel aller Ansprüche, also ein Zehntel oder ein Hundertstel der ihm rechtmäßig zustehenden Kaufkraft besitzt.
Damit Du mir übrigens nicht gleich wieder in die Parade fährst, lieber James, will ich hier gleich einschalten, daß es auch Momente gibt, welche die Gesamtmenge aller Güteransprüche mit der Zeit auf natürlichem Wege vermehren. Der Anspruch unseres Arbeiters, der sich heute wie 1 zu 1 Million verhält, kann auch unter der Herrschaft wirklichen Geldes eines Tages auf das Verhältnis 1 zu 1 1/2 Millionen heruntersinken. Aber dieses Sinken bedeutet keinen Schaden für ihn, denn neue Ansprüche, die auf natürlichem Wege entstehen, sind stets von produktiven Mehrleistungen begleitet. Der Güterbestand in der Wirtschaft erhöht sich infolge dieser Mehrleistungen in solchem Maße, daß auf den einzelnen Anteil, auch wenn er relativ kleiner geworden ist, dennoch dieselbe oder sogar eine größere Gütermenge entfällt wie ursprünglich. Ich werde auf diesen Punkt beim Kapitel „Entstehung des Geldes“ zurückkommen.
Nun noch zu Deinem Einwand, die Wertgleichheit zwischen Geld, Leistung und Gegenleistung sei eine Selbstverständlichkeit. (Du siehst, ich nehme es ernst mit Deinen Einwänden, auch wenn ich nur vermute, daß Du sie machst.) Gewiss ist es selbstverständlich, daß das Geld, das nichts anderes als ein Bezugsrecht auf eine Gegenleistung ist, denselben „Wert“ wie diese hat. Und ebenso selbstverständlich ist es, daß, solange die Gegenleistung denselben Wert wie die vorangegangene Leistung hat, das Geld auch mit dieser „wertgleich“ ist. Leider ist aber diese Selbstverständlichkeit die einzige Antwort, die ich auf die Frage nach dem „Wert“ des Geldes überhaupt zu geben vermag. Denn einen Eigenwert hat das Geld ja nicht und kann es, da es lediglich ein Recht ist, nicht haben.
„Auch wenn das Geld aus edlem Metall besteht?“ höre ich Dich im Geiste fragen, obwohl ich hierauf eigentlich schon geantwortet habe. Also nochmals: Nein, mein Junge, auch dann nicht. Eine goldene Doppelkrone, die Du in den Schmelztiegel wirfst, hat einen bestimmten Wert nicht deshalb, weil sie Geld ist, sondern weil sie aus Gold, d.h. einem begehrten Metall besteht. Läuft die Doppelkrone als Zahlungsmittel im Lande um, so verhält es sich genau so: Ihr Metallgehalt, nicht ihre Geldeigenschaft macht sie wertvoll. Allerdings hat sie im letzteren Falle neben ihrem Eigenwert noch den abgeleiteten Wert, den jedes Geldzeichen in seiner Eigenschaft als Garantie eines Rechtsanspruchs hat, also den Wert, der auch einem papierenen Zahlungsmittel innewohnt. Aber das ist, wie wir gesehen haben, gar kein wirklicher Wert, sondern nur ein „Wert“ in Anführungsstrichen, sozusagen ein Reflex des Güterwerts, auf den das Geld einen Anspruch gewährt. Wir kommen also zu dem Ergebnis: Das Geld trägt keinen Wert in sich selbst, sondern gewährleistet nur den Anspruch auf einen bestimmten Güterwert. Und auch dieser Güterwert ist keine feststehende Größe, sondern schwankt mit der Menge des umlaufenden Geldes. Jedes Geldzeichen verleiht seinem Inhaber ein Anrecht auf einen Teil des jeweiligen Vorrats an Marktgütern. Existieren wenig Geldzeichen, so geht der Gütervorrat in wenig Teile, jeder einzelne Teil ist also wertvoll. Existieren viel Geldzeichen, so gewährt jedes von ihnen nur das Anrecht auf einen kleinen Teil des Vorrats, verkörpert also einen geringfügigen Wert. Wenn Dich jemand fragt, wie wertvoll das einzelne Stück eines Napfkuchens ist, so wirst Du sicherlich antworten: „Das kann ich nicht sagen, solange ich nicht weiß, in wie viel Portionen der Kuchen zerlegt wird.“ Genauso verhält es sich mit der einzelnen Portion des Gesamtvorrats an Gütern, die sich in einem Geldzeichen verkörpert. Ihr Wert hängt ganz davon ab, auf wie viel Geldzeichen der Gesamtvorrat sich verteilt. Die Frage des „Geldwerts“ – beachte freundlichst immer die Anführungsstriche – ist also im Grunde nur eine Frage nach der Geldmenge.
Und damit Gute Nacht!
Dein alter Papa.
5. Brief
Das „Geld“ und die „Geldzeichen“ – Die Wanderung des Geldes – Das unsterbliche Geld
Berlin, am 10. Januar 1921.
Wir wollen uns nunmehr, lieber James, der Frage zuwenden, wie das Geld, entsteht. Wohlgemerkt, das wirkliche, echte Geld, nicht das Scheingeld, das die Staaten heute im Großbetrieb herstellen. Die Entstehung des Scheingeldes ist ganz uninteressant. Es gehört dazu nur ein weites Gewissen und eine Notenpresse. Aber wie ich Dir schon in einem früheren Briefe schrieb: Auf diese Weise kann niemals wirkliches Geld entstehen. Ein Papierzettel wird nicht zu Geld, wenn der Staat ihn als solches bezeichnet und die Bevölkerung zwingt, ihn als Geld anzusehen. Wirkliches Geld entsteht infolge eines ganz bestimmten wirtschaftlichen Vorgangs und hat stets eine Leistung zur Voraussetzung. Es ist kein Geschöpf der staatlichen Rechtsordnung oder der staatlichen Willkür, sondern ein Produkt des Verkehrs. Und so belanglos es ist, zu wissen, was eine Regierung sich dabei denkt, wenn sie ihre bunten Zettel druckt, so interessant ist es, die Entstehung des wirklichen Geldes zu verfolgen.
Du und ich, jeder einzelne Kulturmensch, wohnt täglich der Geburt von Geld bei. Trotzdem sieht es nur selten einer von uns körperlich entstehen. Das scheint rätselhaft und ist doch im Grunde ganz natürlich. Man muss sich nur den Hergang genau vergegenwärtigen.
Jeder Bäcker, der ein Brot verkauft, jeder Handwerker, der eine Arbeit ausführt, verschafft sich dadurch einen Güteranspruch. Machen sie diesen Anspruch sofort geltend, lässt sich also der Bäcker für sein Brot eine Tüte Zucker, der Handwerker für seine Arbeit ein paar Zigarren geben, so hinterlässt der Vorgang keine weiteren Folgen. Wir sprechen dann von einem Tausch. Schieben die Beiden aber die Geltendmachung ihres Anspruchs auf, so werden sie dadurch Inhaber eines Bezugsrechts, das sie zu beliebiger Zeit und in beliebiger Weise ausüben können, und wir sprechen dann von Geldverkehr. Denn jenes Bezugsrecht ist ja nichts anderes als Geld. Trotzdem sehen wir nicht, daß bei dieser Gelegenheit körperliches Geld entstandenwäre. Vielmehr sehen wir, daß das Geld, das der Bäcker und der Handwerker empfangen, und in dem sich das Bezugsrecht verkörpert, bereits vorhanden ist und nur die besitzende Hand wechselt. Wie kommt das? Sollte am Ende die Behauptung, daß bei jeder Leistung, die nicht sofort mit einer Gegenleistung abgegolten wird, Geld entsteht, falsch sein? Und wenn sie falsch ist, wann entsteht dann das Geld in Wirklichkeit? Denn irgendwann, das ist klar, muss jedes Geldzeichen, das sich im Verkehr befindet, entstanden sein.
Die Sache klärt sich auf höchst einfache Weise auf, lieber James, sobald wir korrekt sprechen und die Begriffe „Geld“ und „Geldzeichen“ auseinanderhalten. Die meisten Irrtümer und Missverständnisse entstehen ja daher, daß die Menschen mit einem bestimmten Wort verschiedene Begriffe verbinden, also gleichsam verschiedene Sprachen sprechen und so aneinander vorbeireden. Verstehen wir uns also recht: Der Güteranspruch, den ein Mensch besitzt, die Kaufkraft, die er infolgedessen ausübt, ist „Geld“. Ich habe es Dir ja häufig genug wiederholt, daß Geld nichts materielles, sondern etwas ideelles, nämlich ein Recht ist. Dieses Recht muss natürlich, um respektiert zu werden, äußerlich irgendwie kenntlich gemacht werden. Es kann z.B. in ein öffentliches Buch eingetragen und durch Umbuchung von einem Berechtigten auf den anderen überschrieben werden. In diesem Falle nimmt das ideelle Geld keine körperliche Gestalt, sondern nur die abstrakte Form einer Buchung an. Man spricht dann von „Giralgeld“. Meist zieht man es aber vor, Dokumente über das Recht anzufertigen und den Berechtigten auszuhändigen. Diese Dokumente sind dann „Geldzeichen“ oder „Zahlungsmittel“. Der Sprachgebrauch hat sich leider daran gewöhnt, diese Dokumente ebenso zu nennen wie das in ihnen verbriefte Recht, nämlich „Geld“. Daraus entsteht eine fortgesetzte Konfusion der Begriffe, und Du selbst, mein Sohn, bist vielleicht eben einer solchen Konfusion zum Opfer gefallen. Denn solltest Du Dich wirklich darüber wundern, daß Du noch niemals Geld hast ins Leben treten sehen, obwohl doch stündlich rund um Dich herum tausende von Güterbezugsrechten entstehen, so würdest Du ganz einfach „Geld“ und „Geldzeichen“ miteinander verwechseln. Sobald Du Dich korrekt ausdrückst, fällt der vermeintliche Widerspruch in sich zusammen. Denn daß täglich in unzähligen Fällen neue Bezugsrechte, Geld genannt, zur Entstehung kommen, braucht durchaus nicht zur Folge zu haben, daß über jedes dieser Bezugsrechte ein neues Dokument, Geldzeichen genannt, ausgefertigt wird. Es würde im Gegenteil sogar sehr sonderbar sein, wenn das der Fall wäre.
Warum? Nun, denke einmal ein wenig nach, mein Lieber. Du brauchst nur die Augen aufzumachen und Dir das tägliche Leben anzusehen. Was geht denn bei jedem Kauf und Verkauf vor sich? Wenn der Bäcker dem Arbeiter ein Brot verkauft, so entsteht für den Bäcker auf Grund dieser Leistung ein Rechtsanspruch auf Gegenleistung. Aber das ist keineswegs alles. Es geht dem ein anderer Vorgang parallel. Dem Bäcker, der das Brot verkauft, steht doch der Arbeiter gegenüber, der es kauft, nicht wahr? Auch für diesen hat der Akt eine wirtschaftliche Bedeutung. Und zwar setzt er sich durch den Kauf in den Besitz einer Gegenleistung, auf die er bei der letzten Lohnzahlung einen Anspruch erworben hat. Denn als der Arbeitgeber ihm damals 200 Mark für seine Arbeitsleistung auszahlte, da hat dies bedeutet, daß für den Arbeiter ein ganz bestimmter Rechtsanspruch auf Gegenleistung entstanden ist, der so lange gilt, bis der Arbeiter die Gegenleistung selbst in Gestalt von Stiefeln, Lebensmitteln usw. an sich bringt. In dem Moment, wo dies geschieht, der Arbeiter also ein Paar Stiefel kauft, hat der entsprechende Anspruch zu bestehen aufgehört. Und so bedeutet denn der Kauf des Brotes beim Bäcker nicht nur, daß für den Bäcker ein Anspruch neu entstanden ist, sondern zugleich auch, daß ein genau so großer Anspruch für den Arbeiter erloschen ist. Und wie in diesem Falle, so ist es bei allen übrigen Akten im Handelsverkehr. Der Vorgang, der für die eine Partei einen Verkauf bedeutet und einen Güteranspruch neu entstehen lässt, stellt für die andere Partei einen Kauf dar und lasst einen Anspruch erlöschen. Das ist der Grund, lieber James, warum Du noch niemals Geld hast entstehen sehen: Werden und Vergehen, Geburt und Tod stehen sich hier gegenüber und heben sich gegenseitig auf. Es braucht auf der einen Seite kein neuer Anspruch dokumentiert, kein Geldzeichen frisch geschaffen, auf der anderen Seite aber auch kein bestehender Anspruch annulliert, kein Geldzeichen vernichtet zu werden. Denn der Zweck, den Anspruch des Einen zu sichern und den des Anderen zu löschen, lasst sich auf viel einfachere Weise erreichen, und zwar dadurch, daß der Käufer dem Verkäufer das Dokument über seine bisherigen, im Moment des Kaufs erlöschenden Anspruch übergibt, das heißt, ihm die entsprechenden Geldzeichen aushändigt.
So kommt es, daß die weitaus meisten Menschen Zahlungsmittel niemals entstehen, sondern immer nur von Einem zum Andern wandern, zirkulieren sehen. Es handelt sich hier um ein technisches Hilfsmittel des Verkehrs, der für die Güteransprüche der Bevölkerung eine Art „Clearing“ eingeführt hat. Die Ansprüche werden nicht umständlich beglaubigt und ebenso umständlich annulliert, sondern einfach ausgetauscht, was ungleich bequemer ist.
Auf diese Weise geht der im Gelde verkörperte Güteranspruch immer von der einen Person auf die andere über. Der Arbeitgeber übergibt ihn dem Arbeiter, dieser tritt ihn an den Bäcker ab, der Bäcker leitet ihn an den Müller weiter, der ihm Mehl liefert, der Müller an den Bauer als Gegenwert für dessen Korn, und so zirkuliert der Anspruch durch die ganze Verkehrskette hindurch. Wer etwas geleistet und dadurch ein Bezugsrecht erworben hat, empfängt den Anspruch, wer eine Leistung entgegengenommen und dadurch das entsprechende Bezugsrecht ausgeübt hat, verliert den Anspruch. Der Anspruch als solcher erlischt also nicht, sondern wechselt nur immer die besitzende Hand.
Diese Fortexistenz des Güteranspruchs, diese ewige Wanderung des Geldzeichens, in dem der Anspruch sich verkörpert kann sehr leicht missverstanden werden. Hüte Dich also davor, mein Sohn, in der Zirkulation des Geldes etwas anderes zu sehen als ein technisches Hilfsmittel des Verkehrs, der sich die Sache leicht machen will und daher ein und daßelbe Dokument immer wieder benutzt, statt fortgesetzt neue Dokumente auszustellen und wieder zu annullieren. Vergiss niemals den eigentlichen Sinn des Vorgangs: Wo immer ein Geldzeichen den Besitzer wechselt, ist ein Recht, ein Bezugsrecht auf Güter, erloschen und ein anderes entstanden. In einem Staate, der kein „Umlaufsgeld“, sondern nur „Buchgeld“ kennt, wo also jeder Bürger statt der Münzen und Scheine ein Konto im Staatsbuche hat, wäre das deutlicher zu erkennen als bei uns. Dort würde auf dem Konto des Bäckers, der ein Brot verkauft, ein entsprechendes Bezugsrecht neu eingetragen, auf dem Konto des kaufenden Arbeiters dagegen ein früher eingetragenes Bezugsrecht gelöscht werden. Es wird behauptet, daß es im Altertum tatsächlich Staaten gegeben habe (z.B. Ägypten), bei denen dieses Geldsystem geherrscht hat. Ich selbst glaube allerdings, daß das nur für den Großverkehr denkbar ist der mittlere und Kleinverkehr wird die Darstellung des Geldes durch körperliche Geldzeichen niemals haben entbehren können.
Wir sind bei unserer bisherigen Untersuchung stets nur auf Geldzeichen gestoßen, die von Hand zu Hand wandern, nicht auf solche, die zum ersten Mal im Verkehr auftauchen. Infolgedessen wissen wir noch immer nicht, wie denn nun eigentlich die körperlichen Geldzeichen entstehen. Und ebenso geht es uns mit dem begrifflichen Gelde, dem ideellen Rechtsanspruch auf Gegenleistung. Wir wissen von diesem Rechtsanspruch nur, daß er sozusagen die zweite Hälfte aller Kaufakte und das provisorische Entgelt aller Leistungen bildet; wir kennen also nur das Was, nicht das Wie.
Dagegen haben wir etwas anderes, sehr wichtiges gelernt: Ein Güteranspruch, der einmal besteht, ist ein Ding, das normalerweise nicht wieder vergeht, sondern immer nur wandert, der sich stets von neuem zwischen Leistung und Gegenleistung schiebt und gewissermaßen unsterblich ist. Genau so wenig wie der Geburtsstunde des Geldes hast Du jemals seiner Todesstunde beigewohnt: Es sei denn, daß einmal einer Deiner Freunde in der Weinlaune einen Geldschein als Fidibus benutzt und damit einen Güteranspruch in Rauch hat auf gehen lassen.
Und selbst dann ist das im Gelde dargestellte Bezugsrecht nur für den einzelnen Inhaber, nicht aber für die Gesamtheit erloschen. Oder glaubst Du, daß auf der ganzen Welt irgend ein Gut nur deshalb keinen Käufer findet und verdirbt weil Dein Freund seinen Anspruch auf dieses oder ein anderes Gut verbrannt hat? Nein, das in dem verbrannten Geldzeichen verkörperte Recht ist tatsächlich unsterblich. Wenn sein rechtmäßiger Inhaber auf die Ausübung verzichtet, so geht es automatisch auf die Inhaber der übrigen Bezugsrechte über. Denn jedes einzelne Bezugsrecht lautet nicht auf eine festbestimmte Größe, sondern auf den soundso vielten Teil aller Bezugsrechte, stellt also einen umso größeren Güteranspruch dar, je mehr die Zahl der existierenden Bezugsrechte sich verringert.
Daraus ergibt sich wiederum eine sehr interessante Feststellung: Daß nämlich der Staat kein Geld vernichten kann, auch wenn er es will. Er kann natürlich die Zahl der umlaufenden Geldzeichen verringern, also etwa ein paar Millionen Banknoten einziehen und kassieren. Damit tut er aber nur genau daßelbe wie Dein Freund mit seinem Fidibus. Er nimmt einzelnen Personen ihre in den Geldscheinen verkörperten Bezugsrechte, aber diese Bezugsrechte verschwinden nicht etwa, sondern wachsen den Inhabern der übrigen Geldscheine zu. Auf jeden dieser Geldscheine entfällt jetzt ein höherer Anteil an der Gesamtheit der Güter. Man sagt dann gewöhnlich: „Das Geld ist wertvoller geworden“, und trifft damit das Richtige. Der Güteranspruch, die Kaufkraft, die durch das Geld gewährleistet werden, haben sich tatsächlich im Verhältnis der zahlenmäßigen Verringerung der Geldscheine erhöht.
Wenn ich Dir also in einem früheren Briefe dargelegt habe, daß der Staat aus freier Entschließung heraus kein Geld, d.h. keine Güterbezugsrechte schaffen, sondern nur längst bestehende Bezugsrechte auf andere Personen übertragen, d.h. enteignen kann, so siehst Du hier das Gegenstück dazu: Der Staat kann existierendes Geld, umlaufende Güterbezugsrechte, nicht vernichten, sondern es wiederum nur auf andere Personen übertragen, also die Besitzrechte umschichten. Der Unterschied ist lediglich, daß die Gesamtheit der Güter sich im ersten Falle auf eine vergrößerte, im zweiten Falle auf eine verkleinerte Anzahl von Berechtigten verteilt, was das eine Mal einen Nachteil, das andere Mal einen Vorteil für die einzelnen Geldinhaber bedeutet. Woraus Du im Übrigen nochmals deutlich ersiehst, daß der „Wert“ des Geldes niemals ein absoluter ist, sondern stets in engster Beziehung zur Menge des Geldes steht und mit dieser schwankt.
Nachdem Du nunmehr gesehen hast, lieber James, daß das Geld in der Wirtschaft einem ruhelosen Ahasver zu gleichen scheint, der nicht entsteht und nicht vergeht, sondern ewig wandert, bist Du sicherlich doppelt begierig zu erfahren, wie es sich denn tatsächlich mit der Genesis und dem Untergang des Geldes verhält. Denn einmal, das ist sicher, muss auch ein Ahasver geboren werden und sterben. Ich darf also annehmen, daß Du meinem nächsten Briefe, der schon morgen folgen soll, mit Spannung entgegensiehst.
In Liebe
Dein Papa.
6. Brief
Geburt des Geldes – Hebammendienst des Staates – Geld und Gold
Berlin, am 11. Januar 1921.
Es hilft nichts, lieber James, wir müssen wieder ein wenig rekapitulieren. Also: Geld ist ein Bezugsrecht auf Güter. Dieses Bezugsrecht entsteht, wenn jemand etwas liefert oder leistet, mithin wenn beispielsweise ein Arbeiter dem Arbeitgeber sein Erzeugnis aushändigt; durch die Lieferung entsteht ein Anrecht auf eine gleichwertige Gegenleistung, also ein Güter-Bezugsrecht, und dieses Bezugsrecht heißt „Geld“. Hat der Leistende oder Liefernde sein Anrecht auf Gegenleistung geltend gemacht, hat also unser Arbeiter für sein Geld ein Paar Stiefel, Nahrungsmittel, Zigarren usw. eingetauscht, so ist der wirtschaftliche Vorgang des Austauschs von Leistung und Gegenleistung beendet, und das Bezugsrecht, das den Austausch vermittelt hat, ist erloschen.
Eigentlich müsste sonach viele tausend Mal am Tage Geld entstehen und wieder vergehen. Denn jede der unzähligen Leistungen im täglichen Verkehrsleben lässt ein Bezugsrecht auf Güter, Geld genannt, neu ins Leben treten, und jede der ebenso unzähligen Gegenleistungen vernichtet dieses Bezugsrecht wieder. Der menschliche Verkehr ist aber viel zu praktisch, um ein so umständliches Verfahren anzuwenden. Das würde ein höllisch komplizierter Verkehr sein, bei dem jeder Verkauf eines Brötchens zur Herstellung von Geld, und jeder Ankauf einer Rolle Garn zur Vernichtung von Geld führen würde. Vielmehr hilft sich der Verkehr in der Weise, daß er das Bezugsrecht, das im Gelde dargestellt ist, gewissermaßen objektiviert, daß er es zu einem selbständigen Instrument des Güteraustausches macht, welches ruhig fortbesteht, auch wenn das subjektive Bezugsrecht seines jeweiligen Inhabers erlischt. Dann ist es nicht nötig, Geld neu zu schaffen, sobald der Arbeiter seinen Wochenlohn erhält, und es wieder zu vernichten, sobald er Stiefel und Lebensmittel dafür kauft. Der beabsichtigte Zweck lässt sich viel bequemer erreichen, indem man das nunmehr zu einem selbständigen Verkehrsinstrument gewordene Geld immer aus der Hand desjenigen, dessen Anspruch erlischt in die Hand seines Gegenparts überträgt, der einen entsprechenden Anspruch erworben hat. Jeder Verkäufer erhält also vom Käufer kein neugeschaffenes Geld, sondern Geld, das längst fix und fertig ist und einen Güteranspruch verkörpert, der ebenfalls seit langem existiert. Mit anderen Worten: Man lässt das Geld wandern. Es entsteht nicht und vergeht nicht, sondern zirkuliert.
Das ist die Regel. Diese Regel muss aber doch wohl ihre Ausnahmen haben, denn schließlich kann es sich mit dem Gelde nicht anders verhalten wie mit allen anderen Dingen, die sämtlich einen Anfang und ein Ende haben: Einmal muss jedes konkrete Geldzeichen ebenso wie das in ihm verkörperte abstrakte Bezugsrecht notwendig entstanden sein. Aber welches sind die Umstände, unter denen es entsteht?
Wir müssen uns hier sorgfältig davor hüten, die augenblicklich in Deutschland und anderen Staaten herrschende Geldpraxis etwa als Vorbild anzusehen. Die mechanische Gelderzeugung in diesen Ländern hat mit der Entstehung des wirklichen, echten Geldes, die stets eine organische ist, nicht im entferntesten etwas zu tun. Das Geld, das unsere Notenpressen ausspeien, ist nachgeahmtes Geld; etwa wie die Aktien, die ein unredlicher Gesellschaftsdirektor drucken lässt, und denen keine entsprechende Zunahme des Gesellschaftsvermögens gegenübersteht, nachgeahmte Aktien sind. Beiden, dem Gelde sowohl wie den Aktien, fehlt die wirtschaftliche Entstehungsursache, die allein sie zu echten Dokumenten stempelt. Daß der Verkehr der Unrechtmäßigkeit der Ausgabe weder in dem einen noch in dem anderen Falle merkt, sondern das Geld genau wie die Aktien unbesehen als „vollwertig“ ansieht, ändert nichts an der Tatsache, daß es sich hier wie dort um Falsifikate handelt.
Da Geld nicht ein Güteranspruch schlechthin, sondern ein Güteranspruch von ganz besonderer Art ist und unbedingt zur Voraussetzung hat, daß ihm eine gleichwertige Leistung vorangegangen ist, so sind die Papierscheine, welche die Notenpressen ohne wirtschaftliche Ursache, einfach auf Staatsbefehl, ins Leben setzen, alles andere eher als „Geld“.
Geld, das heißt ein wirtschaftlich berechtigter Güteranspruch, entsteht immer dann und nur dann, wenn jemand etwas geleistet, die Gegenleistung aber noch nicht in Empfang genommen hat. Es ist identisch mit dem Rechtsanspruch auf die ausstehende Gegenleistung. Das Bestehen eines solchen Rechtsanspruchs muss freilich von irgend Jemand konstatiert, formell beglaubigt werden, und normalerweise ist niemand besser befähigt, die Beglaubigung vorzunehmen, als die mit dieser besonderen Aufgabe betraute Behörde eines Rechtsstaats. Aber das ist auch die einzige Hilfe, die der Staat bei der Entstehung des Geldes leisten kann und darf. Seine Fähigkeit und seine Befugnis gehen lediglich dahin, einen ohne sein Zutun im Verkehr neu entstandenen Anspruch zu beglaubigen und ihm die äußere Form vorzuschreiben, in die er sich kleiden soll (Metall-, Papier- oder Buchgeld, kleine oder große Abschnitte usw.). Einen Güteranspruch zu schaffenist er weder befugt noch im Stande. Die Regierung ist, um es drastisch auszudrücken, immer nur die Hebamme, die den neuen Weltbürger in Empfang nimmt und für das Leben vorbereitet, niemals die Mutter, die ihn zur Welt bringt.
Am besten erkennen wir die Umstände, unter denen das wirkliche, Verkehr-geborene Geld entsteht, an Hand eines konkreten Vorgangs aus dem täglichen Leben.
Der Arbeiter, der eine Lohnforderung von 200 Mark hat und von seinem Arbeitgeber das entsprechende Bezugsrecht auf Güter in der gewohnten Form von Geld verlangt, wird in der Regel mit „wanderndem Gelde“ befriedigt. Der Arbeitgeber händigt ihm Zahlungsmittel aus, die er selbst erhalten hat, als er sein Fabrikat (z.B. Äxte) an einen Händler verkaufte; dieser hat sich das Geld seinerseits durch Veräußerung eines Lagervorrats (z.B. von Holz) verschafft, und zwar von einem Handwerker, dem es als Bezahlung für eine abgelieferte Arbeit (etwa einen Tisch) zugeflossen ist. Aber auch der Vorgänger des Handwerkers war nicht etwa der körperliche oder geistige Urheber des Geldes. Er war nur ein Glied in einer langen, langen Kette von Personen, unter denen das Geld zirkulierte, bis es eines Tages in seine Hände kam. Jede einzelne von diesen Personen hat das Geld empfangen, als sie etwas leistete, und hat es wieder fortgegeben, um die Gegenleistung in Gestalt irgendwelcher Güter dafür einzutauschen. Oder anders ausgedrückt, sie hat es empfangen, als sie produzierte, und es fortgegeben, als sie konsumierte. Man kann den Weg, den das Geld genommen hat, durch zahllose Stadien der Erzeugung und des Verbrauchs zurückverfolgen, aber schließlich wird der Weg sich irgendwo im Nebel verlieren. Man wird nur höchst selten jenen Punkt finden, an dem das Geld seine Wanderung begonnen hat, die Stätte, an der es geboren wurde.
Neben diesem normalen Hergang gibt es aber auch eine andere Möglichkeit. Der Arbeitgeber, der dem Arbeiter und Zehntausend seiner Kollegen je 200 Mark schuldet, ist nicht im Stande, den Leuten das Geld zu geben. Er besitzt zwar „Kapital“, nämlich Fabrikräume, Maschinen, Vorräte u. dergl., aber kein Bezugsrecht auf Güter, kein „Geld“. Er hat in der letzten Zeit nichts verkauft, d.h. nichts geleistet, und besitzt daher zur Zeit auch keinen Anspruch auf Gegenleistung, den er den Arbeitern abtreten könnte.
In diesem Falle bleibt dem Arbeitgeber nur die Wahl, unter dem Zwange der Zahlungspflicht nunmehr doch noch etwas zu leisten, also unter ungünstigen Bedingungen Vorräte zu verkaufen, oder Kredit in Anspruch zu nehmen, (d.h. fremde Güterbezugsrechte leihweise an sich zu bringen), oder endlich das Geld, das er nicht besitzt, zu erzeugen. Die Vorbedingungen für die Entstehung von Geld scheinen ja gegeben. Die Arbeiter haben sich durch ihre Leistung einen Anspruch auf Gegenleistung, also ein Güterbezugsrecht, geschaffen, und Geld ist, wie wir gesehen haben, nichts anderes als ein garantierter Anspruch, ein beglaubigtes Güterbezugsrecht. Damit aus dem Rechtsanspruch der Arbeiter „Geld“ wird, ist also nichts weiter nötig, als daß der Anspruch amtlicherseits als rechtmäßig anerkannt und gewährleistet wird.
Der Arbeitgeber begibt sich also zu der Stelle, die der Staat zu diesem Zwecke eingerichtet hat, und ersucht dieselbe, ihm über die Gültigkeit des Anspruchs seiner Arbeiter Dokumente auszufertigen, die dann Geld darstellen würden und zur Bezahlung verwandt werden könnten. Die Stelle aber erhebt Einwendungen. Sie erklärt dem Antragsteller, daß sie den Anspruch der Arbeiter nicht ohne weiteres anerkennen könne. Auf eine einfache Erklärung zweier Parteien hin könne sie kein Güterbezugsrecht bescheinigen. Nicht etwa aus Misstrauen, obwohl sie, wenn sie sich grundsätzlich mit solcher Erklärung zufrieden geben wollte, sofort mit unzähligen Anträgen überlaufen werden würde und viele Milliarden neuen Geldes schaffen müsste. Sondern deshalb, weil sie nichts Unmögliches bescheinigen könne. Wie solle sie wohl im Stande sein, Bezugsrechte auf Güter als rechtmäßig anzuerkennen und durch den Staatsstempel zu legitimieren, solange ihr nicht der Nachweis erbracht sei, daß die Güter, auf die der Anspruch lauten solle, auch tatsächlich vorhanden seien? Wenn sie Güteransprüche beglaubigen solle, so müsse sie die unbedingte Gewähr haben, daß die Ansprüche auch befriedigt werden könnten.
Darauf entgegnet der Fabrikant, die Güter seien vorhanden, denn die Arbeiter hätten sie soeben erst hergestellt; der Anspruch, der ihnen zu bescheinigen sei, bilde ja gerade die Gegenleistung dafür. Die Arbeiter hätten für mehr als 2 Millionen Mark Güter geschaffen und verlangten nun mit Fug und Recht die Beglaubigung ihres wohlverdienten Bezugsrechts auf andere Güter im Werte von 2 Millionen.
Aber die Staatsstelle schließt sich diesem Gedankengang nicht an. Sie meint die Frage, ob durch die Leistung derer Arbeiter wirklich Güter im Werte von 2 Millionen Mark geschaffen seien, entscheide sich erst im Moment des Verkaufs. Es könne sich dann herausstellen, daß die Güter nur den halben Wert oder überhaupt keinen Wert hätten und unverkäuflich seien. Es seien zur Zeit – um irgend eine Ziffer zu nennen – 100 Millionen Mark Geldzeichen im Umlauf. Die Inhaber dieser Geldzeichen, die stündlich wechselten, hätten einen beglaubigten Anspruch auf sämtliche gegenwärtig am Markt befindlicher Güter. Es gebe kein Mittel, in den Besitz eines dieser Güter auf andere Weise zu gelangen – abgesehen von Diebstahl – als durch die Hingabe eines Teils der existierenden 100 Millionen Mark Geldzeichen, deren Inhaber tatsächlich die allein berechtigten Bezieher jener Marktgüter seien. Wollte nun die Staatsstelle die geforderten Millionen neuen Ansprüche beglaubigen, so würden statt 100 Millionen Mark Geldzeichen deren 102 Millionen in Umlauf sein und Ansprüche auf jene Marktgüter erheben, die doch nur für 100 Millionen bestimmt seien.
Davon könne nicht einmal dann die Rede sein, wenn die von den Arbeitern neu her gestellten Fabrikate wirklich und nachweislich einen Wert von 2 Millionen Mark hätten. Allerdings würde in diesem Falle nicht nur auf der Geldseite, sondern auch auf der Warenseite ein Zuwachs um 2 Millionen eintreten. Aber das Exempel gehe dann nicht etwa auf. Die Sache verhalte sich vielmehr folgendermaßen:
Gegenwärtig steht der gesamten Gütermenge, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums an den Markt kommt, und deren Wert wir einmal auf 10 Milliarden Mark beziffern wollen, ein Gesamtbestand von Geldzeichen, d.h. von Güteransprüchen, in Höhe von 100 Millionen Mark gegenüber. Diese 100 Millionen wechseln in demselben Zeitraum durchschnittlich 100 Mal ihren Inhaber. Ist der Zeitraum abgelaufen und der Kreislauf des Geldes beendet, so haben die 100 Millionen Mark Geldzeichen 100 mal 100 Millionen Mark oder 10 Milliarden Mark Güter konsumiert. Die Rechnung geht also bis hierhin glatt auf. Treten nun aber auf der Geldseite und auf der Güterseite je 2 Millionen hinzu, so lautet die Rechnung:
10 Milliarden + 2 Millionen Güter =
100 Millionen + 2 Millionen Geldzeichen.
Es entfallen also nunmehr 10002 Millionen Mark Güter auf 102 Millionen Mark Geld, mithin auf jede Geldeinheit nicht mehr 100, sondern nur noch etwa 98 Gütereinheiten. Mit anderen Worten: Das alte Geld hat infolge der Beglaubigung der 2 Millionen Mark Arbeiter-Bezugsrechte, d.h. infolge der Schaffung von 2 Millionen Mark neuen Geldes, eine Verminderung seiner Kaufkraft erfahren.
Das kommt daher, belehrt die Staatsstelle den Fabrikanten, daß die 2 Millionen Mark neu entstandenen Güter nur einmal auf dem Markt erscheinen, hier einen einzigen Güteranspruch befriedigen und dann endgültig verschwinden, in den Konsum aufgehen. Die 2 Millionen neuen Güteransprüche dagegen, die wir beglaubigen und als vollwertiges Geld anerkennen sollen, leben gewissermaßen ewig. Sie vermitteln einen Kauf nach dem andern, treten immer von neuem mit ihrer Kaufkraft an den Markt und verrichten somit ihre Funktion nicht nur hundertmal, wie in dem eben angeführten Exempel, sondern tausendmal, hunderttausendmal, unzählige Mal. Durch die Anerkennung der 2 Millionen Mark neuen Geldzeichen würden wir also bewirken, daß nach und nach viele Milliarden neue Güteransprüche geltend gemacht werden können, während die Güter, auf Grund deren wir die Ansprüche beglaubigen sollen wie gesagt nur zur Deckung eines einmaligen Anspruchs von 2 Millionen Mark ausreichen.
Deshalb können wir, sagt die Staatsstelle, den Güteranspruch nur unter zwei Bedingungen beglaubigen. Erstens muss uns nachgewiesen werden, daß die Leistung, auf Grund deren Anweisungen auf Gegenleistungen ausgestellt, d.h. neue Bezugsrechte, neue Geldzeichen, geschaffen werden, tatsächlich Güter erzeugt hat, die 2 Millionen Mark wert sind und 2 Millionen Mark wert bleiben. Zweitens müssen diese wertbeständigen Güter uns in natura übergeben werden. Denn wenn wir von der Bevölkerung verlangen sollen, daß sie die neuen Bezugsrechte anerkenne und wertvolle Erzeugnisse dafür hingebe, so müssen wir ihr die Gewissheit verschaffen, daß sie das Bezugsrecht jederzeit gegen ein vollwertiges Gut austauschen kann. Wir müssen ihr garantieren, daß sie für 100 Geldeinheiten stets volle 100 Gütereinheiten und nicht, wie in unserem Beispiel, nur noch 98 Gütereinheiten, oder gar, wie es jetzt in Deutschland der Fall ist, armselige 6 oder 8 Gütereinheiten eintauscht.[2] Deshalb sind die Güter, die den neuen 2 Millionen Mark Geldzeichen entsprechen, uns zu übergeben. Wir werden dann entweder diese Güter selbst mit unserem Stempel versehen und dadurch zu Geldzeichen machen; in diesem Fall haben wir die Gewähr, daß die Güter genau so oft auf dem Markt erscheinen wie die Geldzeichen, also hundertmal, tausendmal, unzählige Male die Nachfrage befriedigen, und nicht nur ein einziges Mal; und jeder Geldinhaber weiß dann, daß er keinen Verlust erleiden kann, weil er ja den Wert, auf den das Geld lautet, in Form eines gleichwertigen Guts in Händen hat. Oder aber wir werden die Güter, um ihre Abnutzung zu verhindern, in Gewahrsam nehmen und für den Verkehr durch papierne Zeichen ersetzen. Diese laufen dann gewissermaßen in Stellvertretung der Güter um, die aber Eigentum der Inhaber jener papiernen Geldzeichen bleiben und jederzeit von ihnen abgehoben werden können. Zur Zeit gilt übrigens – sagt die Staatsstelle – nur ein einziges Gut als geeignet, den Nachweis einer vollwertigen Leistung zu erbringen und die Beglaubigung eines neuen Anspruchs auf Gegenleistung zu rechtfertigen, nämlich Gold. Und zwar aus dem rein äußerlichen Grunde, weil der maßgebende Teil des Auslands nur für dieses Metall einen festen Mindestpreis zahlt und dadurch seinen Wert garantiert.
Der Fabrikant zuckt die Achseln und geht. Denn Gold hat er nicht. Er muss also, um seine Arbeiter zu befriedigen, notgedrungen Lagerware mit Verlust verkaufen, d.h. sich alte, umlaufende Geldzeichen beschaffen, und auf neues Geld verzichten. Der wirtschaftliche Sinn dieses Vorgangs ist, daß nur Derjenige einen Anspruch auf eine Gegenleistung (in diesem Falle das Arbeitspensum von 10 000 Arbeitern) hat, der entweder selbst bereits etwas geleistet hat und daher Geld, d.h. einen Rechtsanspruch auf die entsprechende Gegenleistung, besitzt, oder dem ein Dritter seinen Rechtsanspruch im Wege des Kredits abtritt. Es ist ein wirtschaftlicher Unsinn, vom Staate zu verlangen, daß er die Rechtsansprüche, die sich der einzelne Geschäftsmann nicht durch Leistungen zu verschaffen versteht, also Ansprüche, die er in Wirklichkeit gar nicht hat, beglaubigen, und dem Manne, etwa gegen Wechsel, neues Geld aushändigen solle. „Rechtsansprüche“, die auf solche Weise geschaffen werden, sind in Wahrheit unrechtmäßige Ansprüche, und das Geld, das sie repräsentiert, ist Falschgeld. Es ist die Leistung, die Geld erzeugt, nicht der Staat. Der Staat hat keine andere Aufgabe, als die Entstehung des Geldes aus der Leistung durch sein Siegel zu bestätigen.
Ist es verwunderlich, lieber James, daß diese natürliche, unstaatliche Geldtheorie, die im Gelde kein Pfand und keine Anweisung, sondern ein durch Leistungen erworbenes Recht erblickt, noch niemals nach dem Sinn der Kaufleute gewesen ist? Der Kaufmann glaubt stets einen Gott-gewollten Anspruch auf noch mehr Geld, auf noch mehr Güterbezugsrechte zu haben, als er sich durch seine Leistungen erkauft hat. Er glaubt, es gebe „zu wenig“ Geld im Lande – obwohl es überall so viel Geld, d.h. so viel Rechtsansprüche auf Güter gibt, wie man sich zu erwerben verstanden hat, – und fordert daher den Staat auf, ihm gegen das Versprechen einer späteren Rückzahlung neues Geld, neue Bezugsrechte zu übergeben. Daß der Staat das gar nicht kann, weiß er nicht, und weiß leider auch sehr oft der Staat selbst nicht. Beide, Kaufmann und Staat, glauben viel mehr, daß neue Rechte, neue Bezugsrechte auf Güter entstanden seien, sobald der Staat oder seine Bank frische, dem bisherigen Gelde ähnelnde Scheine drucken lässt. In Wirklichkeit hat man aber keine neuen Rechte geschaffen, sondern man hat aus den Rechtsansprüchen, die im alten, umlaufenden Gelde verkörpert sind, Teile herausgebrochen und diese Teile den Empfängern des neuen Geldes verliehen. Man hat die Inhaber des echten Geldes um genau so viel enteignet, wie man den Inhabern des Pseudogeldes zugewendet hat. Es ist hier von keinem „Recht“ mehr die Rede, sondern nur noch von krassem Unrecht. Wirkliches Geld, das die bestehenden Rechtsansprüche respektiert und eine Vermehrung der ehrlich erworbenen Güterbezugsrechte, einen tatsächlichen Zuwachs von Kaufkraft, darstellt, kann immer nur so entstehen, wie es die apokryphe Staatsstelle in dem vorerwähnten Zwiegespräch mit dem Arbeitgeber gesagt hat: Es muss im Verkehrsleben eine Leistung erfolgt sein, aus der heraus ein Gut entstanden ist, das in sich selbst die Gewähr der größtmöglichen Wertbeständigkeit trägt. Nur derjenige Güteranspruch, der sich auf dieses besondere Gut zurückbezieht, ist echtes, vollwertiges, rechtmäßig entstandenes Geld.
In Liebe
Dein alter Papa.
7. Brief
Die vielen Güter und das wenige Geld – Nutzlauf, Leerlauf und Preis – Produktionsstärke und Geldmenge
Berlin, am 15. Januar 1921.
Das Geld ist gleichbedeutend mit dem verbrieften Anrecht, das sein Besitzer auf einen bestimmten Teil aller Marktgüter hat. Es ist gewissermaßen der Schlüssel, nach dem sich die gesamten Marktgüter unter die Menschen verteilen. Viel Geld bedeutet den Anspruch auf einen großen Bruchteil der Güter, wenig Geld bedeutet den Anspruch auf einen kleinen Teil.
Das ist so klar, mein lieber James, daß ein Kind es begreift. Weniger klar ist dagegen die Mechanik des Verteilungsvorgangs. So befremdet es uns z.B., daß wir auf der einen Seite einen ungeheuren Gütervorrat, auf der anderen Seite aber nur einen verhältnismäßig kleinen Geldvorrat sehen. Es befremdet uns das um so mehr, als der ungeheure Gütervorrat sich täglich neu ergänzt, da ja immer wieder frische Gütermengen auf den Markt strömen, der weit kleinere Geldvorrat jedoch unter normalen Verhältnissen immer ungefähr derselbe bleibt. Wie geht da die Verteilung vor sich? Wie bewältigt der kleine Geldvorrat die großen Gütermengen, und welcher Mechanismus sorgt dafür, daß jeder Einzelne zu seinem Recht kommt, nämlich zu seinem in den Geldzeichen verkörperten Anrecht auf Güter?
Obenhin betrachtet, scheint auch dies ganz klar zu sein. Denn wenn auch die Geldzeichen nur verhältnismäßig gering an Zahl sind, so vervielfältigen sie sich doch durch ihre große Beweglichkeit. Eben noch sah man, wie sie an einer bestimmten Stelle des Verkehrs Güterumsätze bewältigen, und schon erblickt man sie an einer andern Stelle, wo sie wiederum im Begriff sind, Umsätze zu vermitteln. Dieselben Geldzeichen tauchen bald hier, bald dort auf, und wo sie auch sein mögen, immer verteilen sie neue Gütermengen. Je schneller sie die besitzende Hand wechseln, je beweglicher sie sind, um so leistungsfähiger sind sie; genau wie eine kleine, aber schlagfertige Truppe mehr leistet, als ein großes, aber schwerfälliges Heer. Für die Wirksamkeit der Geldzeichen ist also nicht so sehr ihre Anzahl ausschlaggebend, als vielmehr die Häufigkeit ihres Platzwechsels, ihre sogenannte „Umlaufsgeschwindigkeit“.
Aber was besagt das im Grunde? Eröffnet es uns irgend einen Einblick in den Sinn der Wirtschaftsvorgänge, wenn wir wissen, daß der Umsatz von Marktgütern so groß ist, wie die Geldmenge multipliziert mit ihrer Umlaufsgeschwindigkeit? Können wir aus dieser Tatsache irgend eine zuverlässige Folgerung ziehen? Können wir beispielsweise folgern, daß jeder Zunahme der Umlaufsgeschwindigkeit ohne weiteres eine entsprechende Zunahme des Güteraustauschs und der Produktion entspricht? Wenn das der Fall wäre, so besäßen wir ein prächtiges und höchst einfaches Mittel, die Umsätze zu erhöhen und die Wirtschaft zu beleben: Wir brauchten nur das Geld recht schnell rollen zu lassen, also die Lohnzahlungen an die Arbeiter täglich statt wöchentlich und die Begleichung der Miets- und Kapitalzinsen vierzehntägig statt vierteljährlich stattfinden zu lassen. Das Ei des Kolumbus!
Aber auf so einfache Weise lassen sich Handel und Wandel leider nicht beleben. Es gibt zwar naive Leute, die wirklich der Ansicht sind, man könne den „Geldmangel“, den sie wahrzunehmen glauben, dadurch beseitigen, daß man die Geldzeichen ihre Arbeit schneller verrichten lasse und es ist aus diesem Grunde schon häufig vorgeschlagen worden, die Lohn-, Miets- und Zinszahlungen in kürzeren Perioden stattfinden zu lassen. In Wirklichkeit würde aber niemand einen Vorteil von einer solchen Maßnahme haben. Weder der Arbeiter noch der Arbeitgeber, weder der Mieter noch der Hauswirt, weder der Gläubiger noch der Schuldner würden dadurch auch nur um einen Pfennig bereichert werden. Wenn überhaupt eine finanzielle Wirkung einträte, so könnte es nur eine ungünstige sein: Die Lohn-, Miets- und Zinsbeträge würden so sehr zusammenschrumpfen, daß es sich nicht mehr lohnte, sie vor der Auszahlung oder nach der Empfangnahme zur Bank zu geben, d.h. sie produktiv wirken zu lassen. Die Beträge würden sich vielmehr untätig in den Geldschränken und Portemonnaies verzetteln.
Daß es auf die bloße Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes nicht ankommt, erkennt man übrigens am besten, wenn man sich den Geldverkehr am sogenannten Kapitalmarkt und an der Börse vergegenwärtigt. Nirgends läuft das Geld schneller um als hier. In spekulativ erregten Zeiten kann eine Aktie an einem Tage zehnmal und mehr den Besitzer wechseln, was entsprechende Zahlungen auslöst. Aber hat dieser schnelle Geldumschlag den geringsten wirtschaftlichen Effekt? Nein. Damit ist nicht etwa gesagt, daß Geldmarkt und Börse nutzlose Einrichtungen seien. Aber der Nutzen, den sie etwa stiften, hat nichts mit der Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes zu tun.
Es kommt also, wie Du siehst, mein Sohn, nicht darauf an, wie oft und wie schnell das Geld umläuft, sondern darauf, ob es „im Nutzlauf“ oder „im Leerlauf“ zirkuliert. Bringt der Bauer Getreide zu Markt, oder liefert der Handwerker seine Arbeit ab, so ist die Geldbewegung, die dieser Vorgang auslöst, Nutzlauf. Verkauft aber ein Spekulant Aktien, oder vermittelt ein Häusermakler den Besitzwechsel einer Villa, so handelt es sich um einen Leerlauf des Geldes. In einer gesunden Wirtschaft braucht das Geld gar nicht übermäßig schnell zu zirkulieren, wenn es nur bei einer möglichst großen Zahl der Umsätze wirtschaftliche Leistungen vermittelt.
Ob das geschieht oder nicht, hängt aber niemals vom Gelde ab. Weder die Menge noch die Umsatzzahl des Geldes entscheidet darüber, ob die Zahlungsakte, die es vermittelt, nützlich oder schädlich oder neutral sind. Wie sollte das auch möglich sein? Das Geld ist ja weiter nichts als ein verbrieftes Recht, ein Recht zum Bezuge von Gütern. Dieses Recht entsteht dadurch, daß jemand etwas geleistet und sich dadurch den Anspruch auf eine Gegenleistung erworben hat. Wenn das Recht aber erst einmal besteht, kann es durch zahllose Hände gehen, ohne daß notwendig eine Leistung, eine Bereicherung der Wirtschaft, damit verbunden ist. Der Vater kann es seinem Sohn, der Sohn kann es seinem Freunde, dieser kann es irgend einer Dame abtreten. Das sind dann drei Umlaufsakte ohne jeden wirtschaftlichen Nutzeffekt.
Es muß also unbedingt ein Element außerhalb des Geldes geben, das dessen Zirkulation regelt und dafür sorgt, daß die im Gelde dargestellten Güterbezugsrechte möglichst häufig in Erfüllung eines produktiven Zwecks den Inhaber wechseln. Und in der Tat existiert ein solcher Regulator. Er erfüllt die ganze Wirtschaft mit seiner Wirksamkeit, und es vergeht kein Tag, an dem nicht jeder von uns ihm mehrere Male begegnet. Dieser Regulator ist der Preis.
Auf welche Weise der Preis seine regelnde Funktion versieht, ist sehr leicht zu erkennen. Man braucht sich nur die Frage vorzulegen: Wann kauft der Kapitalist Aktien? Wann kauft er eine Villa? Mit an dem Worten, wann verwendet der Inhaber eines Güterbezugsrechts daßelbe unproduktiv, indem er längst bestehende Werte an sich bringt, statt es produktiv zu verwenden, d.h. die betreffenden Werte neu herstellen zu lassen und die Wirtschaft dadurch’ zu bereichern? Die Antwort lautet dann: Er wird Anteile an einem bestehenden Unternehmen (Aktien) erwerben, wenn diese am Ertrag gemessen billiger sind als die Anteile einer erst zu errichtenden Unternehmung und er wird eine fertige Villa kaufen, wenn diese ihn billiger zu stehen kommt als eine neu zu erbauende. Natürlich sprechen die etwaigen Annehmlichkeiten des sofortigen Besitzes alter Objekte bei der Abwägung des Preises ebenso mit, wie auf der anderen Seite die Vorteile (Modernität, längere Lebensdauer) neuer Objekte. Stellt sich unter Berücksichtigung dieser Momente der Preis der Beteiligung an einem neuen Unternehmen oder der Preis einer neu zu erbauenden Villa niedriger, als sich der Preis der alten Objekte stellt, so wird der Kapitalist geneigt sein, zu bauen oder bauen zu lassen, also sein Geld „produktiv“ zu verwenden.
Die meisten Menschen sind nun bekanntlich nicht gesättigte Kapitalisten, sondern Leute, die gezwungen sind, „sich ihr Geld zu verdienen“; das heißt Leute, die sich den Anspruch auf die Güter, die sie zum Leben brauchen, durch Leistungen erkaufen müssen. Die Umwelt hat aber für ihre Leistungen, wie wir gesehen haben, nur dann Verwendung, wenn sie zu einem Preise angeboten werden, der – unter Berücksichtigung aller hierbei mitsprechenden Momente – billiger ist als der Preis der alten, „versteinerten“ Leistungen, die in Gestalt von beweglichen und unbeweglichen Vorräten zum Angebot kommen. Neue und alte Produktion liegen also in ständiger Konkurrenz miteinander. Ich erinnere an ein bekanntes Beispiel: Wie ängstlich studiert der amerikanische Baumwoll-Farmer alljährlich die statistischen Berichte über die Weltvorräte an Baumwolle! Warum? Weil er genau weiß, daß der Preis, den man ihm bieten wird, ganz vom Preise und der Menge der Baumwolle vorjähriger Ernte abhängt. In derselben Lage sind mehr oder weniger alle Produzenten. Sie müssen ihren Preis, d.h. ihren Anspruch auf Gegenleistung, unter einer ganz bestimmten Höhe halten. Tun sie das nicht, so zirkulieren große Mengen Geld im „Leerlauf“ statt im „Nutzlauf“, und die Produktivität im Lande schrumpft ein.
Der Preis zieht also Geld an den Markt der neu produzierten Güter, wenn er niedrig ist, und er stößt Geld von diesem Markte ab, wenn er hoch ist. Im ersteren Falle erhöht, im zweiten ermäßigt er die wirkliche, wirksame Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes. Die Produzenten müssen also „billig“ erzeugen, sie müssen für jeden Anspruch, der aus einer Leistung entstanden ist und ihnen in Gestalt von Geld überlassen wird, eine große Gegenleistung hergeben. Das heißt nichts anderes als: Sie müssen viel erzeugen, wenn sie die wirksame Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes erhöhen wollen. Was ergibt sich hieraus? Es ergibt sich, daß nicht die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes über die Produktion, sondern umgekehrt die Produktion über die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes entscheidet.
Ja, es ergibt sich daraus noch mehr, und zwar eine sehr interessante Tatsache. Da der Produzent in dem Maße, wie er seine Erzeugung verstärkt, in immer schnellerem Tempo Geld an sich heranzieht, so wird er selbst immer konsumkräftiger. Jedes Mal, wenn das Geld in beschleunigtem Kreislauf seine Kasse passiert, gelangt er damit in den Besitz neuer Güterbezugsrechte, die er geltend machen kann. Hat er zunächst durch seine Preisstellung die fremde Nachfrage verstärkt und ihr sein Angebot entgegengesetzt, so verstärkt er jetzt seinerseits die Nachfrage, indem er das durch seine Leistung erworbene Recht auf Gegenleistung ausübt, also das eingenommene Geld wieder ausgibt. Er erhöht auf diese Weise nicht nur seine eigene, sondern die allgemeine Produktion. Die Leistungen werden immer größer und folgen sich immer schneller, und sie erzeugen Ansprüche auf Gegenleistungen, die gleichfalls immer größer und häufiger werden. Da aber ein Anspruch auf Gegenleistung nichts anderes ist als Geld, so folgt daraus, daß jede Zunahme der Produktion das zu ihrer Bewältigung erforderliche Geld selbst beschafft. Sie beschafft es auch dann, wenn keine äußerlich wahrnehmbare Vermehrung der Geldzeichen eintritt, und zwar dadurch, daß sie die vorhandenen Geldzeichen immer schneller anzieht und abstößt, d.h. ihre Umlaufsgeschwindigkeit erhöht.
Auf diese Weise erzeugt die Wirtschaft selbst, ohne Zutun von außen, ohne jede Einwirkung des Staats, neues Geld, sobald sie dessen bedarf, und in genau derjenigen Menge, deren sie bedarf. Wer also sagt, es könne jemals „zu viel“ oder „zu wenig“ Geld zur Bewältigung des Güterverkehrs geben, der hat weder das Wesen des Geldes noch das Wesen des Güterumlaufs erkannt. Geldzirkulation und Güterzirkulation sind ganz einfach identisch, wenn man auch aus Gründen der Bequemlichkeit, vor allem wegen des leichteren Eigentums-Nachweises, die abstrakten „Rechte“ an den zirkulierenden Gütern zu einem selbständigen, konkreten Wirtschaftsfaktor, nämlich zu „Geld“ gemacht hat. Um ein Bild zu gebrauchen: Produktion und Konsum sind der auf- und abgleitende Kolben der Wirtschaftsmaschine, und das Geld ist das Schwungrad, das vom Kolben bald in langsame, bald in schnelle Bewegung gesetzt wird. Diese Bewegung, Umlaufsgeschwindigkeit genannt, wird durch die Schnelligkeit der Kolbenbewegung reguliert. Der Kolben, nicht das Rad, treibt die Maschine. Das Rad ist nur ein technischer Behelf. Es ist vorteilhafter, den Kolben durch das Schwungrad auf den Gang der Maschine wirken zu lassen, als direkt. Es ist vorteilhafter, aber nicht unbedingt nötig. Man kann die Anrechte auf Güter auch ohne das Hilfsmittel des Geldes unter die Bevölkerung aufteilen; das wäre dann Tauschwirtschaft statt Geldwirtschaft. Aber die Tauschwirtschaft ist so schwerfällig und bedarf, da die auszutauschenden Güter fast niemals gleichwertig sind, so sehr der Ergänzung durch den im Kleinverkehr herzlich unbeliebten Kredit (vergl. meinen Brief vom 2. Januar), daß es eine ausschließliche Tauschwirtschaft nirgends gibt und meiner Ansicht nach auch niemals gegeben hat.
Kapiert?
Dein alter Papa .
8. Brief
Arbeitendes und ruhendes Geld – Die Zinsprämie – Produktion und Konsum
Berlin, am 17. Januar 1921.
Wenn jemand etwas leistet, d.h. eine Arbeit verrichtet oder ein Gut fortgibt, so erwirbt er dadurch einen Anspruch auf Gegenleistung, der die Gestalt von „Geld“ annimmt. Mit diesem Anspruch kann er auf verschiedene Weise verfahren. Er kann ihn sofort geltend machen, indem er das Geld wieder ausgibt und sich seinerseits ein Gut oder eine Arbeitsleistung dafür verschafft, also sich z.B. eine Uhr kauft oder einen Anzug machen lässt. In diesem Fall wird das Geld seiner Bestimmung, Güterumsätze zu vermitteln, zurückgegeben; es tut seinen Dienst, es „arbeitet“, wie man zu sagen pflegt. Der Mann kann aber auch anders handeln. Er kann den erworbenen Anspruch auf Gegenleistung unausgenutzt lassen, um erst bei späterer Gelegenheit Gebrauch von ihm zu machen, beispielsweise, um im nächsten Sommer eine Reise zu unternehmen oder sich ein Ruderboot zu kaufen. In diesem Falle liegt das Geld bis zum Sommer untätig im Schrank. Es vermittelt keine Güterumsätze, es arbeitet nicht, und die in ihm verkörperte Kaufkraft bleibt unausgenutzt. Die Kaufkraft „ruht“.
Wenn die meisten Menschen so handeln wie unser Mann im ersten Beispiel, also eingenommenes Geld sofort wieder verausgaben, so zirkuliert die im Lande vorhandene Geldmenge sehr schnell. Es kommen viel Umsätze zu Stande, und es herrscht rege Tätigkeit. Handeln die meisten Menschen aber wie im zweiten Beispiel, lassen sie das Geld also lange Zeit unausgenutzt liegen, so zirkuliert das Geld langsam, die Umsätze sind gering, und das gewerbliche Leben pulsiert schwach. Es kommt somit außerordentlich viel darauf an, ob die Menschen die Gewohnheit haben, die erworbenen Ansprüche auf Gegenleistung schnell oder langsam auszunutzen, d.h. ihr eingenommenes Geld kurze oder lange Zeit aufzubewahren.
Diese Gewohnheit unterliegt aber bestimmten Gesetzen. Es ist fast niemals reine Willkür, ob eine Volksgemeinschaft so oder anders handelt, sondern es hängt von der Eigenart der Wirtschaft ab. Eine Bevölkerung, die darauf rechnen kann, daß sie einen Geldbetrag, den sie heute ausgibt, morgen schon wieder einnimmt, wird mit der Ausgabe nicht lange zögern, sondern das Geld schnell wieder in den Verkehr zurückfließen lassen. Eine Bevölkerung dagegen, die nicht mit einer schnellen Rückkehr des Geldes rechnen kann, muß mit dem vorhandenen Gelde haushalten, wird es also nur allmählich und zögernd verausgaben. Mit anderen Worten: Schneller Verdienst gibt aus, langsamer Verdienst spart.
Aber die Schnelligkeit des Verdiensts ist ihrerseits wieder keine Zufallserscheinung, sondern wird gleichfalls von Wirtschaftsgesetzen bestimmt. Jede Einnahme von Geld, d.h. jeder Anspruch auf Gegenleistung, will durch eine Leistung erworben sein. Wer viel leistet, zu dem kehrt das Geld schnell, wer wenig leistet, zu dem kehrt es langsam zurück. Es genügt aber nicht, daß der einzelne Mann selbst intelligent und fleißig sei, damit ihm ein schneller Verdienst zufließt. Auch die anderen Männer, mit denen er im Erwerbsleben zu tun hat, also alle Glieder der Volksgemeinschaft, müssen sein wie er, auch sie müssen viel leisten. Denn wenn sie das nicht tun, haben sie nichts, womit sie die Arbeit des fleißigen Mannes bezahlen können; sie haben keine Gegenleistung, um seine Leistung zu honorieren. Voraussetzung für schnellen Verdienst und entsprechend schnelle Geldzirkulation ist also eine allgemeine Regsamkeit im Lande, ist eine große Güterproduktion. Und es ist ja auch ganz klar, daß jeder Einzelne um so schneller und umso mehr verbrauchen kann, je schneller und je mehr die ganze Volksgemeinschaft erzeugt.
Die Zirkulationsgeschwindigkeit des Geldes, d.h. die Tatsache, ob die einzelnen Geldzeichen lange oder kurze Zeit in ein und derselben besitzenden Hand bleiben, ist nicht nur entscheidend für die größere oder geringere Nachfrage, die am Markte herrscht und die Produktion anregt, sondern sie ist zugleich ihrerseits wieder abhängig vom Grade der Produktivität im Lande. Somit entscheidet im Grunde lediglich die nationale Erzeugungskraft über die Schnelligkeit und Größe der Nachfrage. Die Produktion bestimmt den Konsum, und ein schneller Geldumlauf, bei dem viel Geld „arbeitet“ und wenig Geld „ruht“, ist nur das äußere Zeichen einer lebhaften gewerblichen Tätigkeit. Den Anstoß zu dieser Tätigkeit liefert die geistige und körperliche Befähigung der Bevölkerung, neue Güter mit möglichst geringem Kraft- und Materialaufwand, d.h. zu billigem Preise, zu erzeugen. Und zwar muss der Preis so billig sein, daß es für die Bevölkerung vorteilhaft wird, sich nicht mehr mit den vorhandenen Gütern, wie Häusern, Bahnen, Schiffen, Maschinen usw., zu begnügen, sondern neben diesen alten Gütern neue in Benutzung zu nehmen. Die zunehmende Fähigkeit zu einer solchen Produktions-Verbilligung nennt man „Fortschritt“.
Sonach sind „Arbeit“ und „Ruhe“ des Geldes vom Stande der nationalen Produktivität abhängig. Sie sind Objekt“ nicht Subjekt der Betriebsamkeit. Aber obwohl es so ist“ gibt es doch ein Mittel, sie, wenigstens äußerlich und dem Anscheine nach, zum Subjekt der Betriebsamkeit zu machen, die Wirtschaft also vom Gelde aus zu beeinflussen. Es gibt ein Mittel, die Produktion dadurch zu beleben“ daß man künstlich „ruhendes“ Geld in „arbeitendes“ Geld umwandelt, also das Geld zu einer Tätigkeit zwingt, die es freiwillig nicht ausüben würde. Man kann zum Beispiel den Mann, von dem wir vorhin gesprochen haben, und der sein Geld zum Zweck einer Sommerreise oder späteren Ankaufs eines Boots ruhen lassen wollte, veranlassen, seine Absicht aufzugeben und das Geld wieder in Umlauf zu setzen, es sofort wieder arbeiten zu lassen. Das Mittel, mit dem man dies bewirkt, ist der Zins.
Der Zins ist weiter nichts als die Prämie, die man den Inhabern ruhenden Geldes dafür gewährt, daß sie den im Gelde verkörperten Güteranspruch, den sie selbst bis auf weiteres nicht geltend machen wollen, interimistisch an Dritte abtreten, die ihn sofort auszunutzen beabsichtigen. Die Einführung des Zinses, d.h. der Leihgebühr für ruhende Güteransprüche, in die Wirtschaft ist ein höchst raffiniertes Mittel, mit dem man die Geldbesitzer zwingt, die Güteransprüche, die sie besitzen, sofort auszuüben oder ausüben zu lassen, und so eine Nachfrage am Markt zu erzeugen, die sonst fehlen würde. Der Zwang besteht in dem Appell an den menschlichen Eigennutz und erweist sich meist als sehr wirksam. Denn jeder Geldbesitzer, der sein Geld daran hindert, zu arbeiten, und es untätig im Kasten liegen läßt, wird dafür bestraft, indem er den Zins verliert, den er sonst erhalten würde.
Hier muss man nun aber genau Obacht geben, daß man nicht einem schweren In turn zum Opfer fällt. Denn es sieht angesichts des intimen Verhältnisses, in dem Zins und Geld zu einander stehen, ganz so aus, als sei das Geld der eigentliche Motor der Wirtschaft; ein so wichtiger Motor, daß man ein regelmäßiges und oft sehr hohes Entgelt für seine Benutzung bezahlt. Aber das ist eine Augentäuschung. Man schlägt auf den Sack und meint den Esel. Man spricht von Geld und denkt dabei nur an die Güter, auf die es ein Bezugsrecht gewährt. Das lässt sich übrigens ganz deutlich erkennen. Wenn ich heute einem Fabrikanten oder einem Bankier zehn Millionen Mark in Geldzeichen auf ein Jahr leihe, daran aber die Bedingung knüpfe, daß er das in den Geldzeichen verkörperte Güterbezugsrecht nicht ausübe, sondern das Geld ruhig liegen lasse, so wird mir der Fabrikant oder der Bankier nicht einen Pfennig Zinsen dafür zahlen. Warum nicht? Nun einfach deshalb, weil den Leuten nicht das Geringste am Gelde selbst liegt, um so mehr aber an den Gütern, auf die das Geld ein Anrecht gewährt, und die man sich nur dann verschaffen kann, wenn man das Geld wieder fortgibt, es an den Markt bringt.
Streng genommen sind es nicht einmal die Güter an sich, für die der Geldentleiher eine Gebühr, einen Zins, zahlt. Denn wenn ich dem Bankier oder Fabrikanten vorschreiben wollte, daß er nur dieses oder jenes Gut für meine zehn Millionen Mark beziehen dürfe, etwa ein Haus oder eine Münzsammlung, so wird er mir wiederum keinen Zins bewilligen. Er wird dies auch dann nicht tun, wenn ich ihm zwar die Güterauswahl freistelle, aber von ihm verlange, daß er die Güter konsumtiv verwerte, daß er z.B. gekauftes Holz verbrenne, gekauften Zucker verzehre. Er vergütet mir den Zins nur dann, wenn ich ihm das Geld für denjenigen Zweck überlasse, den er selbst im Auge hat. Und dieser Zweck ist nicht auf den Besitz und den Konsum eines bestimmten Gutes gerichtet, sondern auf die Arbeit, auf die Leistung, die ihm der Besitz des Gutes ermöglicht. Der Textilindustrielle z.B. bezahlt mir für mein Geld nicht deshalb einen Zins, weil er sich dafür soundsoviel Wollgarn hinlegen kann. An dem Besitz dieses Gams, an dessen Lagerung in seinen Räumen, ist ihm nicht das mindeste gelegen. Sondern er bezahlt mir den Zins, weil ich ihm mit meinem Gelde eine Leistung ermögliche, nämlich eine Veredelung des Gams zu Stoff. Das Garn ist wie das Geld nur Mittel zum Zweck. Die Leihgebühr erhalte ich für die Ermöglichung einer Leistung, und ich erhalte sie aus dem Nutzen, den die Leistung für die Allgemeinheit hat. Ich erhalte sie, exakt gesprochen, dafür, daß der Industrielle für seine Leistung mehr Güteransprüche erlöst, als er mir schuldet, indem er mehr Geld als meine zehn Millionen Mark einnimmt. Er tritt mir einen Teil des Güterzuwachses ab, um den er die Welt mit seiner Arbeit bereichert hat, zu der ich ihn mit meinem Gelde befähigt habe.
Der einzelne wirtschaftende Mensch hat also seine Pflicht noch nicht ganz erfüllt, wenn er viel geleistet und dadurch einen Anspruch auf viel Gegenleistungen erworben hat. Er muß, um ein nützliches Glied der Gesellschaft zu sein, den Anspruch auch geltend machen; er muß die Gegenleistung beziehen oder, wenn er sie selbst nicht sofort verwenden kann, den Bezug einem Dritten überlassen. Tut er das nicht, sondern bewahrt er den Anspruch in Form von Geld jahrelang auf, um das Güterbezugsrecht erst spät oder gar nicht auszuüben, so prellt er die Gesamtwirtschaft und verletzt er den Sinn des Geldverkehrs, der ein Austausch von Leistung und Gegenleistung ist. Hat die Umwelt ihm seine Leistung abgenommen, so hat sie Anspruch darauf, daß man ihr auch ihre Gegenleistung abnimmt. Sonst sucht sie für dieselbe vergeblich Abnehmer auf dem Markt, und die Produktivität nimmt mangels entsprechender Nachfrage ab. „Wer arbeitet, soll auch essen.“ Wer produziert, soll konsumieren. Sonst gerät die Wirtschaft in Unordnung.
Das wirtschaftliche Instrument, mit dem diese Gefahr einer Stockung in der Wirtschaft vermieden wird, ist der Zins, der eine Prämie auf den sofortigen Bezug von Gegenleistungen setzt, und zwar, – wie weise ist doch die Wirtschaft eingerichtet! – auf den produktiven Bezug von Gegenleistungen, also auf die sofortige Beschaffung von Gütern, die eine Anwendung von Arbeit gestatten und dadurch den Güterbestand im Lande erhöhen. Andrerseits sorgt aber der Zins auch dafür, daß nicht mehr Güter produziert werden, als die Konsumfähigkeit rechtfertigt. Würden beispielsweise alle Geldinhaber darauf verzichten, die Gegenleistung, auf die sie Anspruch haben, in Form von verzehrbaren und verbrauchbaren Gütern zu beziehen, sondern würden sie, um Zinsen einzunehmen, grundsätzlich die ganze Gegenleistung an die Produzenten abtreten, so würde die Erzeugung sehr bald über die Verbrauchsmöglichkeit hinausgehen. Die Produzenten würden vergeblich nach Abnehmern für ihre Waren suchen. Darum steigt der Zins, eben die Prämie für Überlassung von Güterbezugsrechten, sobald die Produktivität hinter dem Konsum zurückbleibt, und er sinkt, sobald das Umgekehrte eintritt. Er sinkt dann so lange, bis die Zinsprämie den Geldinhabern ungenügend erscheint, so daß diese es vorziehen, selbst zu konsumieren oder zum mindesten die Produktion nicht mehr durch Überlassung von Güterbezugsrechten zu verstärken.
Der Zins ist also, wie Du siehst, ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor, lieber James. Er bestimmt Tempo und Richtung der Produktion und stimmt Erzeugung und Verbrauch auf einander ab. Er zieht Güterbezugsrechte an, wenn er hoch ist, und stößt sie ab, wenn er niedrig ist, er füllt und leert auf diese Weise die Sammelbecken, aus denen die nationale Produktion die nötigen Antriebskräfte bezieht. Diese Sammelbecken aber sind der Geldmarkt und die Banken.
In Liebe
Dein alter Papa.
9. Brief
Die Voraussetzung des Geldmarkts – Die Güterbezugsrechte und die dritte Hand
Berlin, am 20. Januar 1921.
Wir haben uns daran gewöhnt, lieber James, den Geldmarkt als etwas Selbstverständliches anzusehen. Er gilt uns als der unentbehrliche Treffpunkt, an dem diejenigen, die im Besitz zeitweilig entbehrlichen Geldes sind, Leute suchen und finden, die für dieses Geld Verwendung haben und einen Zins dafür bezahlen. Auf seinen eigentlichen wirtschaftlichen Sinn reduziert heißt das: Der Geldmarkt scheint uns deshalb unentbehrlich, weil Jeder, der ein Bezugsrecht auf Güter besitzt, das Bezugsrecht aber noch nicht ausüben will, hier Gelegenheit hat, es Dritten gegen eine Leihgebühr abzutreten. Hier gibt es Leute, die Verwendung für produktive Güter wie Werkstätten, Maschinen und Fabrikate oder für Arbeit und Rohstoffe haben, aus denen Werkstätten, Maschinen und Fabrikate hergestellt werden, und die ihm dafür, daß er ihnen den Bezug dieser Dinge mit seinem Gelde ermöglicht, gern einen Anteil an ihrem Produktionsgewinn in Gestalt eines Zinses einräumen. Was sollte wohl, so argumentieren wir, Derjenige anfangen, der viele Güterbezugsrechte besitzt (viel Geld hat), sie aber selbst nicht zu verwenden vermag, wenn es keinen Geldmarkt gäbe, an dem er die Rechte ausleihen kann, und keinen Kapitalmarkt, an dem sich die Rechte verkaufen lassen? (Der Unterschied zwischen Geldmarkt und Kapitalmarkt wird in der Regel nicht beachtet. Er besteht darin, daß am Geldmarkt Gelder, d.h. Güterbezugsrechte auf Zeit ausgeliehen werden, während am Kapitalmarkt dieselben Gelder, dieselben Güterbezugsrechte, definitiv abgetreten, gegen sogenannte Anlagewerte ausgetauscht, also verkauft werden).
Trotzdem ist der Geldmarkt an sich entbehrlich. In einem Lande, wo die sozialen Verhältnisse der Bevölkerung einigermaßen gleichmäßig sind, wird ein Geldmarkt nicht gebraucht, und wenn er dennoch existiert, so spielt er hier keine große Rolle. Wozu bedarf es eines Geldmarkts z.B. in einem Agrarlande, in dem fast jeder Einwohner sein Stück Land hat, das ihn heute ernährt, und das in dreißig Jahren seine Kinder nähren wird? Er tauscht seine Produkte in Geld, d.h. in Güterbezugsrechte, ein und bezieht dann dafür die Waren, die er braucht. Nimmt er viel Geld ein, so kauft er viel Waren, andernfalls kauft er wenig. Er hat keinen Grund, einen Teil der im Gelde verkörperten Bezugsrechte nicht auszuüben, auf den Kauf von Waren systematisch zu verzichten und das Geld zu „sparen“. Das kann anders werden, wenn sich im Lauf der Zeit so viel Grundbesitz in einer Hand vereinigt, daß der Besitzer mehr Geld einnimmt, als er, ohne zu verschwenden, für Waren ausgeben will oder kann. Aber dann findet er ohne weiteres einen Nachbarn, der ihm das Geld abnimmt und verzinst. Er besitzt nunmehr ein Kapital, dargestellt in einer Lorderung an den Nachbarn, also etwa in einer Hypothek. Es ist nicht nötig, daß in einem solchen Lande der Leihgeldverkehr, der Austausch von Güterbezugsrechten, marktmäßig organisiert wird.
Auch in einem industriell fortgeschrittenen Lande kann es Brauch sein, daß jeder Gewerbetreibende das Recht zum Bezuge von Gütern, welches er mit seinen Produkten erwirbt, selbst ausübt, daß er also für sein Geld Verbrauchsgüter kauft und etwaige Überschüsse, die seinen Bedarf übersteigen, zur Erweiterung seines Betriebs verwendet, oder seinen Kindern damit eine Existenz schafft, indem er ihnen Betriebe einrichtet. Ein Ende hat es mit dieser patriarchalischen Verwendung der im Gelde dargestellten Bezugsrechte erst dann, wenn eine sehr große Ungleichheit des Besitzes die Regel geworden ist. In Ländern wo die Bevölkerung in „Two nations“ zerfällt, nämlich in eine reiche Oberschicht, die den größten Teil des Bodens und aller Betriebsmittel besitzt, und ein entwurzeltes Proletariat, das nichts oder wenig hat außer der Arbeit seiner Hände, in solchen Ländern hört die Verwendung des Geldes durch den Eigentümer selbst notwendig auf.
Der Proletarier, der keinen Rückhalt an eigenem Besitz hat, und der stets befürchten muss, bei eintretendem Alter oder verminderter Arbeitsfähigkeit ohne Verdienst und ohne Existenzmittel dazustehen, der auch seinen Angehörigen keine Einkommensquelle hinterlässt, muss wohl oder übel einen Teil seines Einkommens unverbraucht lassen. Für ihn heißt es: „Spare in der Zeit, so hast Du in der Not!“ Er muss Bezugsrechte auf Güter für sein Alter und seine Familie reservieren, wenn er nicht sehr leichtfertig handeln will. Tut er es nicht selbst, so muss es der Staat im Wege der Sozialgesetzgebung für ihn tun. Beides läuft auf daßelbe hinaus. Es werden Güterbezugsrechte dem sofortigen Verbrauch durch ihre Eigentümer entzogen, für spätere Jahrzehnte aufgesammelt und bis zum Eintritt des Zeitpunkts ihrer Verwendung an Dritte ausgeliehen. Dabei handelt es sich um ganz gewaltige Summen, die in der Statistik der staatlichen Versicherungsanstalten, der Sparkassen, der kleinen Lebensversicherung usw. zum Ausdruck kommen. Ihre Bewegung erfordert eine Organisation, und diese Organisation ist der Geldmarkt.
Eine ganz ähnliche Veränderung tritt bei der entgegen gesetzten Bevölkerungsschicht, bei den Großkapitalisten, ein. Die Ursachen sind hier aber zum Teil anderer Art. Allerdings besteht auch in diesen Kreisen, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen, das Bestreben, sich Reserven für die Zukunft zu schaffen; denn in einem auf Industrie und Großkapitalismus eingestellten Land wechseln die Konjunkturen schnell, und ein Sturz in die Tiefe liegt für den Einzelnen durchaus im Bereich der Möglichkeit. In der Hauptsache aber ist der Verzicht auf sofortige und selbständige Geltendmachung der Güterbezugsrechte ganz einfach darauf zurückzuführen, daß sich in einer und derselben Hand viel mehr solcher Rechte ansammeln, als vernünftigerweise ausgenutzt werden können, viel mehr Geld, als selbst bei luxuriösen Lebensgewohnheiten für den Tagesbedarf ausgegeben werden kann. Das Geld in den eigenen Betrieb zu stecken, wie es der Landwirt gern tut, widerstrebt aber dem modernen Kapitalisten. Er setzt nicht gern alles „auf eine Karte“ und arbeitet, wenn er sein Unternehmen sehr stark ausdehnt, lieber mit fremdem Gelde als mit dem seinigen. Auch der Kapitalist, und er ganz besonders, braucht also einen Markt, an dem er sich seiner überschüssigen Güterbezugsrechte auf kürzere oder längere Zeit entledigen kann.
So sehen wir, daß der Geldmarkt ganz und gar kein Naturprodukt, keine wirtschaftliche Elementar -Erscheinung ist, sondern daß er nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen zu einem Bedürfnis wird. Heute ist das allerdings in allen Kulturländern der Fall, weil sie in den letzten Jahrzehnten eine ausgesprochen großkapitalistische Entwicklung durchgemacht haben. Das Geld muss heute einen besonderen Markt haben, weil auf der einen Seite ein immer größerer Überschuss Verwendung sucht, auf der andern Seite das Bedürfnis nach einer Reserve für die Zukunft immer dringender wird; beide Momente bewirken, daß die „dritte Hand“ bei der Geldverwendung nicht mehr entbehrt werden kann.
Tatsächlich hat jedes Land nicht nur einen Geldmarkt, sondern daneben noch zahlreiche kleine Märkte, von denen jeder einen Zu- und Abfluss zum großen Zentralmarkt hat. Die kleinen Märkte sind die Banken. Bei ihnen sammeln sich die Gelder der „Two nations“, in erster Linie fließen ihnen die Überschutzgelder der kapitalistischen Kreise zu. Ihre Aufgabe ist es, die dritte Hand zu suchen, welche die in den Geldern verkörperten Güterbezugsrechte so zweckmäßig ausnutzt, daß über den Zins, hinaus, der dem Eigentümer zu vergüten ist, ein hoher Überschuss für die Volksgemeinschaft erzielt wird. Von ihren Kreditprinzipien hängt es ab, welche Verwendung die Produktivgüter finden, und nach welcher Richtung hin sie die Wirtschaft des Landes entwickeln. Denn gleichviel, ob die Banken die dritte Hand selbst finden, welche die Güter verwalten und zu ertragreichem Kapital um wandeln soll, oder ob sie sich dabei der Mitwirkung des großen Zentralmarktes bedienen, immer ist die Auswahl unter den Verwaltungsberechtigten ihnen überlassen. Das macht die ungeheure Verantwortung der Banken und zugleich ihre Machtstellung aus, die sie oft zu einem Staat im Staate werden lässt.
Da die Banken vermittels ihrer Kredithoheit der wirtschaftlichen Entwicklung die Wege vorzeichnen, so hätten sie es eigentlich in der Hand, die bedenkliche Tendenz zu mildern, welche die Bevölkerung in zwei feindliche soziale Lager spaltet und dadurch den Bestand des Staats gefährdet. Sie hätten es in der Hand, die ihnen zur Verteilung überlassenen Güterbezugsrechte in solche Kreise zu leiten, die nicht an der Verstärkung des Proletariats mitwirken. Sie könnten den gewerblichen Mittelstand und das Handwerk fördern und dadurch dem rasenden Wachstum des Großkapitals Grenzen setzen. Leider verfahren die Banken aber in den meisten Ländern nicht so, sondern gerade entgegengesetzt. Sie führen die unverwendeten Überschüsse des Kapitals wiederum dem Kapital zu und verstärken so die geldkonzentrierende Tendenz, die zwar den Geldmarkt immer unentbehrlicher und mächtiger macht, die Wurzeln des Staats aber allmählich vollkommen untergräbt.
Zum Teil wirken hierbei egoistische Gründe mit. Aber um gerecht zu sein, eine erhebliche Mitschuld trifft dabei den Staat und seine Gesetzgebung. Da die Banken anvertrautes Gut verwalten und nicht nur aus privatrechtlichen Gründen, sondern auch infolge ihrer öffentlichen Stellung, als Herren der wirtschaftlichen Entwicklung im Lande, verantwortlich für die Intaktheit der ihnen überlassenen Gelder sind, so müssen sie ihr Hauptaugenmerk auf das Moment der Sicherheit legen. Als der geeignetste Verwalter der Gelder erscheint ihnen daher immer derjenige, der die größte Gewähr für pünktliche Rückerstattung bietet, und das ist naturgemäß der Großkapitalist. Der kleine Mann bietet eine solche Gewähr nicht, seitdem die Staatsgesetze, im Streben nach Humanität, den unzuverlässigen Schuldner in weitgehendem Maße vor der Verfolgung durch den Gläubiger schützen. Als es noch den Schuldturm gab, war der Handwerker und Kleingewerbler ein verhältnismäßig sicherer Debitor, dem Kredit ohne weiteres zur Verfügung stand. Die drohende Gefängnisstrafe machte ihn vorsichtig und zu einem verlässlichen Verwalter fremden Geldes. Heute droht ihm der Schuldturm nicht mehr, aber er selbst trägt den Schaden, denn er ist nun nicht mehr kreditwürdig. Es verhält sich mit diesem sozialen Akt der Gesetzgebung wie mit so vielen anderen: Er erschlägt diejenigen, die er schützen will, und ist daher in Wirklichkeit im höchsten Grade unsozial.
Das darf man nicht ganz außer Acht lassen, wenn man den Banken den Vorwurf macht, sie trieben großkapitalistische Kreditpolitik und handelten nach dem Prinzip: „Wer da hat, dem wird gegeben.“ Eins aber ist sicher: Auf dem jetzigen Wege der Überfütterung des Kapitals, sozusagen der kapitalistischen Inzucht, darf es nicht mehr lange weitergehen, wenn es nicht zum „Zusammenbruch des Abendlandes“ von innen heraus kommen soll.
Und noch in einem anderen Punkte haben die Banken umzulernen; das ist die Zinspolitik. Der Zins ist jener hochwichtige Faktor im Wirtschaftsleben, der darüber entscheidet, ob die im Gelde verkörperten Güterbezugsrechte jeweils in produktivem oder in konsumtivem Sinne ausgeübt werden müssen. Der Zins ist das Zünglein an der Waage des wirtschaftlichen Gleichgewichts und zeigt genau an, ob die Schale der Produktion oder die des Konsums entlastet werden muss. Wird dieser Index missbraucht, wird ihm zum Trotz die Produktion mit Hilfe der bei den Banken zentralisierten Gelder weiter gesteigert, obwohl ihre Schale sich längst gesenkt hat, so bricht eine Wirtschaftskrisis aus, die bei richtiger Politik vermieden werden könnte. Das wirkliche Verständnis für die Symptome der Konjunkturen wird in den Bankbüros heute noch allzu sehr durch Schematismus und Routine ersetzt.
Während der nächsten Tage muß ich mich der Bilanz meiner Bank widmen, lieber James. Wundere Dich also nicht, wenn zwischen diesem Brief und dem nächsten etwas mehr als die gewohnte Zeit vergeht.
Herzlichst
Dein Papa
10. Brief
Das Prinzip der Notenbank – Der „Goldwahn“ – Geldmenge und Dritteldeckung – Notenbank und Konversionskasse
Berlin, am 26. Januar 1921.
So alt wie das Geld, lieber James, so alt ist auch die Klage der Menschen, es gebe „zu wenig Geld“. Das ist ein Missverständnis, von dem ich nicht zu hoffen wage, daß es jemals ganz aus der Welt verschwinden wird. Es werden wohl immer nur ganz Vereinzelte sein, die erkennen, daß „zu wenig Geld“ ein Widersinn ist. Geld ist der Maßstab, nach dem sich die vorhandenen Güter auf die Bevölkerung verteilen, und man kann die einzelnen Güter-Portionen nur vergrößern, indem man die Gütermenge erhöht, nicht aber, indem man den Maßstab verlängert. Wer darüber klagt, daß er zu wenig Geld hat, klagt in Wirklichkeit nur darüber, daß er nicht genug Waren oder Leistungen hat absetzen und sich daher nur eine kleine Portion der vorhandenen Gütermenge hat beschaffen können. Das kann eine Frage der persönlichen Unfähigkeit oder eine Frage der sozialen Ungerechtigkeit sein, niemals aber eine Frage der Geldmenge.
Da die große Masse das aber nicht einsieht, so fordert sie vom Staat, daß er mehr Geldzeichen herstelle, und der Staat erkennt diese Forderung als grundsätzlich berechtigt an, indem er Notenbanken errichtet, die „nach Bedarf“ Geldzeichen ausgeben sollen. Dabei setzt er der Schöpfertätigkeit der Banken freilich gewisse Grenzen. Wenn aber schon seine Anerkennung des öffentlichen Geldverlangens uns ein wehmütiges Lächeln abnötigt, weil sie auf einem Irrtum beruht, so wirken die „Grenzen“ , die er dem Verlangen setzt, vollends humoristisch. Denn der Staat pfropft hiermit seinem ersten Irrtum einen zweiten auf.
Wie die beiden Irrtümer entstanden sind, ist durchsichtig genug. Der Staat hat sich im Laufe der Jahrhunderte, durch Schaden gewitzigt, zu der Erkenntnis durchgerungen, daß nicht jedes Geld den in ihm dargestellten Güteranspruch wirklich voll gewährleistet, also „wertbeständig“ ist. Er hat vielmehr erkannt, daß nur solch Geld, das entweder selbst aus Edelmetall (Gold) besteht, oder jederzeit in dieses Edelmetall umgetauscht werden kann, die Eigenschaft der Wertbeständigkeit hat. Dabei ist ihm jedoch der Grunddieser Tatsache verborgen geblieben. Er sieht darin nur den Ausfluss einer menschlichen Laune eines Vorurteils. Er führt die Wertbeständigkeit des Goldgeldes oder Gold gedeckten Geldes darauf zurück, daß die Menschen nun einmal nur ein Geld, für das sie jederzeit den vollen Gegenwert in dem edlen Weltmetall erhalten können, für wert echt halten. Wenn das auch nur eine Marotte sei, die wohl aus der traditionellen Überschätzung der Edelmetalle herrühre, so müsse man ihr doch Rechnung tragen und möglichst nur solch Geld ausgeben, das auf Wunsch seines Inhabers jederzeit in Metall umgetauscht werden könne.
Das ist aber ein In turn. Die tatsächliche Überlegenheit des Goldgeldes – im östlichen Weltteil des Silbergeldes – hat eine weit tiefere Ursache als die Laune oder den Eigensinn der großen Masse. Die verhältnismäßige Wertbeständigkeit des Goldgeldes rührt vielmehr daher, daß die Erzeugung solchen Geldes der staatlichen Willkür entzogen ist. Goldgeld kann nur entstehen, wenn Gold produziert und an den Markt gebracht, wenn also etwas geleistet wird. Die Forderung, daß die Leistung und nur die Leistung Geld entstehen lasse, ist beim Goldgelde (oder bei dem voll durch Gold gedeckten Gelde) in idealer Weise erfüllt. Es kann von solchem Gelde niemals mehr entstehen, als der menschliche Verkehr, der Leistung gegen Leistung austauscht, rechtfertigt und braucht. Und da die Menge des Geldes bzw. das Verhältnis zwischen dieser Menge und den Leistungen über die Kaufkraft, über den „Wert“ des Geldes entscheidet, so ist das Goldgeld, bei dem die Menge bzw. das Verhältnis keine willkürliche Verschiebung erfahren kann, wertbeständig. Genau so wertbeständig würde aber auch jedes andere Geld sein, daß ausschließlich aus der Leistung entsteht, das also vom Verkehr selbst erzeugt und nicht nach irgend welchen Prinzipien von außen her dem Verkehr auf gezwungen wird.
Das erkennt, wie gesagt, der Staat nicht. Er glaubt an eine fixe Idee der Völker, an eine Art „Goldwahn“, und versucht nun, diesem Vorurteil durch eine bestimmte Geldpolitik Rechnung zu tragen. Er ermächtigt also die Notenbanken, das Verlangen des Volks nach „mehr Geld“ unter der Voraussetzung zu erfüllen, daß die ausgegebenen Noten in gewisser Höhe durch Gold gedeckt seien. Die Notenmenge könne beliebig hoch gegriffen werden, wenn nur immer Gold genug vorhanden sei, um diejenigen Noteninhaber, die in ihrem „Goldwahn“ etwa einmal Metall zu erhalten wünschten, aus dem Bestände befriedigen zu können. Da erfahrungsgemäß in normalen Zeiten im Durchschnitt nur jeder zehnte oder fünfte, allerhöchstens jeder dritte Noteninhaber Gold gegen seine Noten verlange, so genüge es, wenn der Metallbestand ein Drittel des Gesamtbetrages der ausgegebenen Noten ausmache. Sei diese Bedingung erfüllt, so könnten die Banken ruhig jede Notenmenge in Umlauf setzen, die dem „Verkehrsbedürfnis“ entspreche; das letztere lasse sich am besten aus der Zahl der bei den Banken zur Diskontierung eingereichten kaufmännischen Wechsel erkennen.
Aus diesem Gedankengang heraus sind alle existierenden Notenbanken entstanden. Das Prinzip ist überall daßelbe, wenn man auch bei der einen Bank das Vorhandensein von 40 Prozent Gold statt von 33 1/3 Prozent zur Bedingung macht, bei einer anderen Bank wieder irgend eine Ziffern mäßige Höchstgrenze für die auszugebenden Noten festsetzt; eine Höchstgrenze die fast regelmäßig heraufgesetzt wird, sobald das „Verkehrsbedürfnis“ es zu fordern scheint. Das Privileg aller Notenbanken beruht also auf dem zweifachen Irrtum, daß der „Wert“ des Geldes mit der umlaufenden Geldmenge im Lande nichts zu tun habe, und daß nur das Gold bzw. die Möglichkeit eines Umtauschs in Gold dem Gelde seine Wertbeständigkeit verleihe. Während es sich in Wirklichkeit gerade umgekehrt verhält: Das Gold hat als solches gar keinen, die Geldmenge dagegen den alleinigen Einfluss auf den „Geldwert“.
Daher kommt es, mein Lieber, daß alle Notenbanken ohne Ausnahme versagt haben, sobald sie die Probe auf das Exempel machen und dem Verkehr – etwa im Kriege oder in einer Krisis – eine erheblich vermehrte Notenmenge zur Verfügung stellen wollten. Ihre Noten haben dann sofort einen Teil ihrer Kaufkraft eingebüßt, und die Noteninhaber haben die Banken wegen Umtauschs der Noten in Gold bestürmt, weil nur dieses, nicht nach Willkür vermehrbare internationale Geld seinen Wert behielt. (Es behielt seinen Wert nicht deshalb, weil es Gold war, sondern weil es das einzige nicht beliebig vernehmbares Geld und obenein ein internationales Geld war). Es hat sich dann sehr bald herausgestellt, daß die goldene Dritteldeckung nicht entfernt ausreichte, um alle Ansprüche zu befriedigen, und man hat daher den Umtausch eingestellt, die Einlösung der Noten in Gold suspendiert. Zu diesem Mittel, das ja den Bruch eines dem Volk gegebenen feierlichen Versprechens bedeutet, hat man allerdings immer erst gegriffen, nachdem andere, mildere Mittel versagt hatten. Vorher versuchte man es entweder mit einer kleinen Spitzbüberei, indem man den Noteninhabern statt vollwertiger goldener Münzen alte, abgegriffene und nicht mehr vollwichtige Stücke aushändigte, sie also um einen Teil ihrer Goldforderung brachte, nicht um sie zu schädigen, sondern um sie abzuschrecken. Oder man versuchte es mit dem Schandpfahl: Man erklärte jeden Noteninhaber, der in diesem kritischen Moment Goldansprüche an die Notenbank stellte, für einen Vaterlandsverräter. Tatsächlich waren aber alle diese Mittelchen bereits ein verschleierter Rechtsbruch und der erste Schritt auf dem Wege zur glatten, offenen Suspension der Goldzahlung.
In einigen Ländern haben denn auch die Regierungen allmählich erkannt, daß das ganze Notenbank- Prinzip auf einer fehlerhaften Kenntnis des Geldwesens beruhe. Aber nur einzig und allein England hat von allen europäischen Staaten die Energie aufgebracht, mit dem Prinzip zu brechen. Dort wurde 1844 durch die berühmte Peels Act bestimmt, daß außer den damals umlaufenden Noten keine neuen mehr in Verkehr gesetzt werden dürften. Nur gegen Gold sollten fortan neue Noten ausgegeben werden; für jede Note sollte ihr voller Betrag in Gold bei der Bank hinterliegen. Mit anderen Worten: Nicht mehr der Staat oder die von ihm privilegierten Banken, sondern der Verkehr sollte, wie es in der Natur der Dinge liegt, neues Geld erschaffen; Staat oder Bank sollten sich fortan darauf beschränken, die Tatsache, daß durch Übergabe von Gold, also durch eine Leistung, Gold entstanden sei, mittels Prägestempels oder mittels eines Gold-Zertifikats (Banknote) zu konstatieren. Weil England auf diese Weise die Bank als Geldschöpferin ausgeschaltet und sich ein Geld geschaffen hat, das aus dem lebendigen Verkehr heraus geboren wurde, hat das Land bis zum großen Kriege das beste Geld der Welt, das einzige wirklich wertbeständige Geld gehabt. Als man dann aber im Kriege die Gelderzeugung wieder zu einer Angelegenheit des Staats und seiner Notenpresse machte und dem Verkehr neue, nicht aus ihm selbst heraus entstandene Geldzeichen aufdrängte, war es natürlich mit der Vollwertigkeit des im Gelde dargestellten Güteranspruchs vorbei.
Daraus ergibt sich, lieber James, daß eine schlechte, geldausspeiende Notenbank schädlich, eine gute aber überflüssig ist. Denn die mechanische Aufgabe, das im Verkehr entstandene Geld zu beglaubigen, kann jedes Münzamt versehen. Es scheint auch, als wenn diese Erkenntnis hie und da zu keimen beginnt, weniger in Europa als in Südamerika. Dort haben einige Staaten, als sie an die Sanierung ihres Geldwesens gingen, bewusst auf die Gründung von Notenbanken verzichtet und statt dessen „Konversionskassen“ errichtet, d.h. Kassen, welche die Entstehung neuen Geldes lediglich beglaubigten, indem sie für deponiertes Gold Anerkenntnisse ausgaben, die im Verkehr wie Gold selbst zirkulierten. Vox populi, die immer nach „mehr Geld“ schreit, ist damit allerdings nicht zufrieden, und da es innerpolitische Augenblicke gibt, in denen man der „Straße“ nachgehen muss, so ist es fraglich, wie lange beispielsweise in Argentinien die Vernunft in Gelddingen die Oberhand behalten wird.
Und wir in Europa? Wir haben in den letzten Jahren so teures Lehrgeld gezahlt, daß wir eigentlich allmählich auf die Höhe der argentinischen Erkenntnis gelangen müssten. Aber meine Hoffnung ist in dieser Hinsicht nicht sehr groß. Bei uns wird zu viel geschwatzt und zu wenig gedacht.
In Liebe
Dein alter Papa.
11. Brief
Der bargeldlose Zahlungsverkehr – Das „Giralgeld“ – Unsichtbare Inflation
Berlin, am 28. Januar 1921.
Die schlimme Wirkung, lieber James, die eine willkürliche Geldvermehrung auf den „Geldwert“, d.h. auf die Größe des im Gelde verkörperten Güteranspruchs, ausübt, wird meist erst ziemlich spät erkannt. Die Wirkung muss schon recht tief gehen, die Geldverschlechterung einen unheilvollen Grad erreicht haben, bevor der Staat oder die Notenbanken zugeben, daß die Entwertung des Geldes eine Folge ihrer eigenen falschen Geldpolitik sei. Haben sie das aber erst einmal erkannt und den Zusammenhang zwischen der Geldentwertung und der sogenannten „Inflation“ öffentlich zugegeben, so ereignet sich allemal etwas, was man amüsant nennen könnte, wenn es nicht so ernste Folgen hätte. Staat oder Notenbank suchen dann nämlich die Inflation auf eine ganz bestimmte Weise zu mildem, und zwar auf eine Weise, die deutlich zeigt, daß man den Zusammenhang zwischen Geldverschlechterung und Inflation ahnen und doch sehr laienhafte Ansichten über das Geld haben kann.
Die Notenbank – wir wollen den Staat einmal aus dem Spiel lassen – argumentiert nämlich folgendermaßen: Es ist nicht daran zu zweifeln, daß es ein Fehler war, so große Mengen von Banknoten auszugeben und dadurch den Wert des Geldes zu schwächen. Man müsste also den Versuch machen, einen Teil der Banknoten wieder einzuziehen, aber so, daß keinem Inhaber einer Banknote daraus ein Verlust erwächst. Am besten eignet sich zu diesem Zweck der bargeldlose Zahlungsverkehr. Man bringt den Inhabern der eingezogenen Banknoten den Gegenwert auf einem Konto gut und veranlasst sie, ihre Zahlungen nunmehr nicht mehr in bar, d.h. mit Noten, sondern mittels Überweisung von ihrem eigenen Konto auf das Konto der anderen Bankkunden zu leisten. Auf diese Weise gewinnen alle Beteiligten: Der Verkehr wird einen Teil des übermäßigen Notenumlaufs los, was günstig auf den Geldwert einwirkt; die Bank weist entsprechend weniger Noten in ihren Ausweisen aus, was die Kritik verstummen läßt; und die Bankkunden, die ihre Noten gegen ein Konto ausgetauscht haben, genießen die Vorzüge des Überweisungsverkehrs gegenüber dem Barverkehr. Jeder hat einen Vorteil, niemand einen Verlust. Probatum est.
Darum, mein lieber Sohn, wirst Du stets, wenn die Inflation und die Währungsnot einen hohen Grad erreicht haben, das Loblied des bargeldlosen Zahlungsverkehrs singen hören. Mit Bitten und Drohungen, mit aufklärenden Schriften und mit den bekannten Imperativen („Zahle bargeldlos!!“ „Fördere den Überweisungsverkehr“ „Bekämpfe die Inflation!“) wird auf die Öffentlichkeit eingewirkt, damit sie ihre Noten abliefere und sich dafür ein Konto einrichten lasse, sei es bei der Notenbank selbst, sei es bei einer andern Bank, die ihrerseits in unbarem Verkehr mit der Notenbank steht. Tatsächlich hat die Propaganda auch meist Erfolg. Die Privatguthaben bei den Banken, die Bankguthaben bei der Notenbank erfahren eine nennenswerte Steigerung, die deutlich zeigt, wie viel Noten man hätte ausgeben müssen, wenn das Publikum jetzt nicht vielfach mit Scheck und Überweisung statt mit Banknoten zahlte.
Nur eins bleibt aus, und das ist der – Erfolg. Die Tatsache, daß man so und so viel Milliarden Noten einziehen kann, oder nicht auszugeben braucht, weil der Verkehr sich statt ihrer jetzt des Kontos für seine Zahlungen bedient, übt nicht die geringste Wirkung auf den Geldwert und auf die Preise aus. Und man fragt sich mit Sorge, welchen Fehler man denn jetzt wieder begangen habe. Denn da es feststehe, daß nur die übergroße Zahl der Geldzeichen schuld an der Geldverschlechterung und der damit identischen Teuerung sei, so müsse die Verringerung der Notenzahl doch eine Geldverbesserung und einen Preisabbau herbeiführen. Man findet aber in der Regel keinen triftigen Grund, sondern kommt schließlich zu der Ansicht, man habe wohl noch nicht genug auf dem Gebiet des bargeldlosen Verkehrs geleistet. Es müsse noch ungleich mehr unbar gezahlt werden, die Banknote müsse allmählich vollständig aus dem Großverkehr verschwinden. Und von neuem setzt die Propaganda ein: „Zahle bargeldlos!“
Wie gesagt, das wäre sehr amüsant, wenn es nicht in so erschreckender Weise zeigte, auf welchem Tiefstand die Erkenntnis des Geldes und seiner Gesetze auch dann noch steht, wenn man endlich den Zusammenhang zwischen Inflation und Währungsnot begriffen hat. Denn, um es kurz zu sagen, mein Lieber: Der ganze Gedanke, die Inflation durch die Förderung des bargeldlosen Verkehrs bekämpfen zu wollen, ist hanebüchener Unsinn. Der bargeldlose Verkehr mag unter Umständen (durchaus nicht immer!) eine sehr nützliche Einrichtung sein. Aber der Inflation kann er aus einem sehr einfachen Grunde nicht entgegenwirken, nämlich weil er – selbst ein Teil der Inflation ist.
Geld ist ja, das kann gar nicht oft und laut genug gesagt werden, nicht etwa nur identisch mit den Geldzeichen, die man im Verkehr antrifft. Das Geld ist seinem Wesen nach gar nichts Materielles, sondern etwas Abstraktes: Ein Recht zum Bezuge von Gütern. Ob dieses Recht sich in Goldbarren, in Münzen, in Kassenscheinen, in Banknoten, oder endlich in Giroguthaben verkörpert, ist vollständig gleichgültig. Worauf es ankommt, ist immer einzig und allein, daß nur so viel Güterbezugsrechte existieren, wie der Verkehr mit seinen täglichen Leistungen und Gegenleistungen aus sich selbst heraus erzeugt. Jede Note und jedes Giroguthaben, das auf diese natürliche Weise entsteht, ist gutes, gesundes Geld. Und jede Note, jedes Giroguthaben, das vom Staate oder einer Bank willkürlich geschaffen wird, ist überschüssiges, schlechtes Geld. Ob man die willkürlich ausgegebenen Banknoten ruhig im Umlauf lässt, oder ob man sie einzieht und durch Buchguthaben, sogenanntes „Giralgeld“ ersetzt, ist ohne jeden Belang. Oder sind etwa die zu Unrecht ausgegebenen Bezugsrechte auf Güter aus der Welt geschafft, weil man sie nun nicht mehr körperlich in Noten, sondern unkörperlich im Giroverfahren von Hand zu Hand gehen lässt? Wird auch nur eine einzige Kaufkraft im Lande weniger ausgeübt, wenn unbar statt bar gezahlt wird? Und nur darauf kommt es doch an: Es muss weniger Kaufkraft ausgeübt werden, wenn man die Güterpreise ermäßigen, oder, was daßelbe ist, den „Geldwert“ erhöhen will.
Man tut, wenn man die Unlogik eines Gedankens nachweisen will, immer gut, den Gedanken bis in seine letzten Konsequenzen hinein zu verfolgen. Wir wollen uns deshalb einmal vorstellen, der Appell, den die Regierungen und die Notenbanken an die Öffentlichkeit richten, hätte den außerordentlichen Erfolg, daß nunmehr sämtliche Zahlungen, außer den allerkleinsten, nicht mehr mit Bargeld, sondern im Giroverkehr geleistet werden. Man würde also nunmehr alle Geldzeichen, die 50 Centimes oder 2 Mark übersteigen, einziehen und dadurch den Geldumlauf um neun Zehntel oder noch mehr einschränken können. Was wäre die Folge? Würde eine einzige Nachfrage deshalb unterbleiben? Würden die Giroguthaben, welche die Notenbank nunmehr den Beamten und Staatslieferanten neu einräumt, auf den Verkehrsumfang und auf die Preise aller Waren anders einwirken als vorher die Noten? Und stellen wir uns, um bis ans Ende zu gehen, einmal vor, ein drakonisches Gesetz verbiete alle baren Zahlungen ohne Ausnahme, zwinge also den Kleinverkehr, mit Postschecks zu zahlen, wie der Großverkehr jetzt mit Bankschecks zahlt: Was wäre die Folge? Die Banknoten, die zur Begründung eines Postscheckkontos oder eines Bankkontos eingereicht werden müssten, könnten nunmehr allerdings ohne Ausnahme eingestampft werden. Das sichtbare Geld würde verschwinden, und mit ihm die sichtbare Inflation. Aber wir würden dagegen nichts anderes eingetauscht haben als unsichtbares Geld und eine unsichtbare Inflation. Der Verkehr würde genau so kaufen, liefern und bezahlen wie vorher, nur daß die einzelne Zahlung nicht mehr durch Übergabe eines Geldzeichens, sondern durch eine Buchung erfolgt. Technisch hätte sich alles, sachlich absolut nichts geändert.
Also Vorsicht bei der Beurteilung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs! Es wird viel Missbrauch mit ihm getrieben, und viele Irrtümer sind mit der Propaganda für ihn verbunden. Geld ist Geld, auch wenn es unkörperlich auftritt. Ja, es kommt in der Form des Bankguthabens, in der Form des „Giralgeldes“, dem eigentlichen Geldbegriff sogar noch näher als in der körperlichen Form der Münze oder der Note. Denn erst jetzt, wenn es als Forderung in einem Buche steht und als Überweisung bald diesem, bald jenem „gutgeschrieben“ wird, tritt der wahre Charakter des Geldes als eines abstrakten Rechts, eines Rechts zum Bezuge von Gütern, deutlich hervor; während es bisher noch immer eine Konfusion zwischen diesem Recht und seinem körperlichen Vertreter, zwischen dem Gelde selbst und den Geldzeichen, gegeben hat.
In Liebe
Dein alter Papa.
12. Brief
Wirkungen der Geldverschlechterung – Inflation und Moral – Ausstrahlungen der Währung und Wirtschaftsleben
Berlin, am 31. Januar 1921.
Es ist eine altbekannte Erscheinung, lieber James, daß in einem Hause, in dem ein Schwerkranker liegt, meist eine einzige Person den ganzen Ernst der Krankheit nicht erkennt, nämlich der Kranke selbst. Er glaubt sich leidlich wohl zu befinden, sobald er etwas Appetit hat. Wie diesem Kranken, so geht es auch den Völkern, die am Gelde krank sind, am Verfall ihrer Währung leiden: Weil sie essen, trinken und Geschäfte machen wie früher, glauben sie es könne nicht so schlimm um sie bestellt sein; der Niedergang des Geldwerts sei ja freilich unangenehm und habe manche üblen Folgen, aber schließlich gebe es ernstere Krankheiten für ein Volk. Besehe man nämlich die Sache bei Licht, so sei die ganze Währungsfrage im Grunde nur ein harmloses Multiplikations-Exempel. Man müsse einfach alle seine Ausgaben mit 10 oder 100 oder 1000 multiplizieren, entsprechend der Geldentwertung bzw. der Steigerung der Preise. Sachlich habe das gar nichts zu bedeuten, denn jede Ausgabe des Einen sei eine Einnahme des Andern, und demnach stiegen auch die Einnahmen auf das 10, 100 oder 1000fache. Man müsse sich nur daran gewöhnen, allen Zahlen im Verkehrsleben eine Null anzuhängen.
Diese harmlose Auffassung kann man vielfach äußern hören. Und in der Tat: Schadet es einem Volke viel, wenn es mit dem großen statt mit dem kleinen Einmaleins rechnet, und wenn alle seine Umsätze sich verzehnfachen? Schließlich ist doch auch zehnmal so viel Geld im Lande wie früher, um die Umsätze zu bewältigen. Die Aufblähung aller Ziffern ist ja überhaupt erst die Folge dieser gewaltigen Geldzunahme.
Dieser Harmlosigkeit, mein Sohn, kann man gar nicht nachdrücklich genug entgegentreten, denn die Unkenntnis, die sich in ihr äußert, grenzt ans Verbrecherische. Es ist schlimm genug, wenn ein Volk in ahnungslosem Leichtsinn die schiefe Ebene der Inflation hinuntergleitet. Wenn es dann aber die Folgen, die dieses Hinab gleiten mit sich bringt, geflissentlich ignoriert oder ihnen die beste Seite abzugewinnen sucht, statt dem Staat in die Zügel zu fallen und rechtzeitig zu bremsen, so eilt das Volk seinem Verhängnis entgegen. Denn um es in dürren Worten zu sagen: Der Verfall seiner Währung ist wohl das größte Unglück, das ein Volk treffen kann. Selbst ein verlorener Krieg bringt ihm nicht so schweren unmittelbaren Schaden, wie der Ruin seines Geldwesens.
Die Leute, die in der ganzen Frage nur ein belangloses Rechenexempel erblicken, übersehen nämlich einige begleitende Momente des Währungsverfalls. Sie übersehen vor allem den einen, bedeutungsvollen Umstand: Die Entwertung des Geldes, also die Multiplikation der Ausgaben, trifft die Gesamtheit. Das Gegenstück hierzu, die Steigerung der Einnahmen, kommt aber nur einem Bruchteil der Bevölkerung zugute, diesem freilich in solchem Maße, daß das Verhältnis zwischen Einnahme und Ausgabe sich bei ihm ganz außerordentlich verbessert. Und zwar ist es in der Hauptsache das Kapital, soweit es Sachwerte besitzt, das in dieser Weise profitiert. Auf der anderen Seite, die von der Geldentwertung lediglich das Moment der Ausgabensteigerung kennen lernt, befinden sich aber, abgesehen von den Rentnern, die besonders schwer geschädigt werden, in der Hauptsache die geistig und körperlich arbeitenden Klassen, die Beamten und die Staatspensionäre.
Wie es kommt, daß die Einen die Inflation als einen nie wiederkehrenden Glücksfall, die Anderen dagegen dieselbe Inflation als eine Katastrophe empfinden, lässt sich nicht in wenig Worten darlegen. Der Mechanismus, der das bewirkt, ist ziemlich kompliziert. Aber wenn man den Vorgang roh skizzieren will, so kann man wohl sagen: Jeder, der in Geld ausgedrückte Ansprüche, wie Zins, Rente, Gehalt, Lohn, Pension u. dergl. besitzt, wird in dem Maße der Geldverschlechterung geschädigt. Jeder, der gewisse Realwerte, wie Grundbesitz, Vieh, Mobiliar, Lagervorräte u. dergl. besitzt, wird normalerweise weder geschädigt noch begünstigt, weil die Realwerte um ungefähr so viel im Preise steigen, wie das Geld, in dem der Preis ausgedrückt wird, an Kaufkraft verliert. (Gewaltsame Schädigungen, wie die der Hausbesitzer durch die Wohnungspolitik des Staats, bleiben hier außer Betracht). Jeder endlich, der werbende Werte, also Fabrikanlagen und Maschinen, besitzt und mit ihnen Realwerte erzeugt, sowie jeder, der diese Erzeugnisse vertreibt, profitiert von der Inflation; und zwar deshalb, weil die Verkaufspreise seiner Produkte, also seine Einnahmen, sich dem sinkenden Geldwert schneller anpassen, d.h. schneller steigen, als seine Ausgaben für Lohn, Miete, Zins, Abgaben usw., und weil dieses günstige Verhältnis nicht einmal, sondern viele Male, mit jedem Verkaufsakt von neuem, in Erscheinung tritt. Kurz gesagt: Die erste Klasse wird durch die Inflation zu Gunsten der dritten Klasse enteignet.
Nun könnte man sich auf den Standpunkt stellen, Mitleid sei nicht Sache der Volkswirtschaft, und man dürfe den Vorgang nicht durch die Brille der Sentimentalität ansehen. Der eine steige hoch, der Andere sinke herab, das sei nun einmal Menschenschicksal. Es komme nicht auf den Einzelnen, sondern auf die Gesamtheit an. Aber gerade hier sitzt der Haken: die Gesamtheit nimmt nämlich bei diesen Vorgängen, obwohl sie nur bestimmte Volksklassen anzugehen scheinen, den allerschwersten Schaden.
Zunächst in moralischer Hinsicht: Im ganzen Volke, selbst wenn es die Geradheit und Ehrlichkeit selbst ist, schwindet allmählich jedes Gefühl für Recht und Billigkeit. Nämlich deshalb, weil alle Klassen, sogar die Inflationsgewinnler, sich vom Staat betrogen glauben. Und in der Tat, wir wissen, daß das Geld ein Recht ist, nämlich ein Recht zum Bezuge von Gütern ganz bestimmten Werts. Und was Recht ist, muss bekanntlich in einem Ordnungsstaat auch Recht bleiben. Kein Recht aber muss sicherer stehen und längeren Bestand haben, als das Besitzrecht, das im Gelde verkörpert ist, denn im Vertrauen auf seinen Bestand schließen Staaten und Völker heilige Verträge ab, die 100 Jahre und mehr Gültigkeit haben. Dieses Recht, dieses Recht aller Rechte, hat der Staat, der den Geldwert durch Inflation dezimiert hat, auf das Gröblichste verletzt. Jeder Arbeiter, jeder Beamte, jeder Rentner, jeder Pensionär fühlt sich durch den Staat, der doch das Recht schützen soll, um das Seinige geprellt. Aber auch die Nutznießer der Geldverschlechterung, die sozusagen vom Fett der Allgemeinheit zehren, fühlen sich durch den Staat in ihren Rechten bedroht, denn von ihnen fordert der Staat die Steuern, die er braucht, um das von ihm selbst verschuldete Elend wenigstens einigermaßen zu lindern. Da nun nur wenige der Nutznießer den wirklichen Zusammenhang zwischen ihren Einnahmen und dem Unglück der Anderen kennen, die meisten vielmehr ihrer eigenen Tüchtigkeit zuschreiben, was nur die Wirkung der Inflation ist, so betrachten sie es als einen Gewaltakt und eine Entrechtung, wenn der Staat ihnen einen Teil ihres Gewinns fortsteuern will. Daher die allgemeine „Steuerflucht“, in der die Rechtsverwirrung der Inflationsgewinnler zum Ausdruck kommt. Die Rechtsverwirrung der Inflationsopfer gelangt in Unbotsamkeit, Gesetzesverletzung, Arbeitsverweigerung, Diebstahl, schließlich Revolution und Mord zum Ausdruck. Es kommt zu einem Kampf aller gegen alle, der den Staat erschüttert und oft genug zum Auseinanderfallen bringt.
Denn wenn wir heute sehen, daß das Unrecht, das die Inflation den Arbeitern, den Beamten, den Angestellten usw. zugefügt hat, zu einem größeren oder kleineren Teil durch Lohn- und Gehaltsaufbesserungen wieder gutgemacht worden ist, – wodurch ist das erreicht worden? Nur durch Kämpfe, durch unausgesetzte, erbitterte, rücksichtslose Kämpfe. Freiwillig findet ein Ausgleich zwischen den Nutznießern und den Opfern der Inflation niemals statt; der Ausgleich muß Schritt für Schritt durch Streiks, Drohungen, Hetzreden, Aufpeitschungen der Volksleidenschaften erkämpft werden. Heute ficht der Arbeiter gegen den Arbeitgeber, morgen der Bauer gegen den Städter, übermorgen das Stadtvolk gegen den „wucherischen“ Händler, der Mieter gegen den Hausbesitzer, und so fort. Das ganze Land zerfallt in unzählige Brandherde, und jeder dieser Brandherde bedeutet eine Feuersgefahr für den Staat. Das ist die soziale und politische Seite der Geldverschlechterung.
Ich habe, wie Du weißt, lieber James, in meinem Bibliothekzimmer ein Archiv, dem ich Zeitungsmeldungen über wichtige oder interessante Vorgänge einverleibe. Jeder, der Einblick in dieses Archiv, und zwar in das Rubrum „Geld, Währung“, nimmt, der sieht mich befremdet an. Denn er findet unter diesem Stichwort Meldungen über Streiks, Putsche, Eisenbahnüberfälle, Raub, Defraudation, Selbstmord, Wucher, Hungertot und vieles andere, was ihm ganz und gar nicht hierher zu gehören scheint. Es gehört aber doch alles dahin. Denn die Wirkungen des Währungselends brechen an den scheinbar ab gelegensten Stellen des Wirtschaftskörpers durch. Da lese ich z.B. etwas über Wohnungsnot. Wohin damit? Unter „Geld“. Denn die Mietpreispolitik des Staats, die das Bauen neuer Häuser verhindert, ist die notwendige Folge der Enteignung des halben Volks durch die Geldentwertung. Ich lese etwas über ein 16 Milliarden-Defizit der Eisenbahnen. Wohin? Unter „Geld“. Denn das Defizit rührt zum Teil daher, daß die Bahnen ihre durch die Inflation geschädigten Beamten hoch entlohnen müssen, und daß andererseits der größere, „enteignete Teil der Bevölkerung die entsprechenden Fahrpreise und Gütertarife nicht bezahlen kann. Ich lese etwas über Kohlennot: Nicht unter „Spa“, sondern unter „Geld“! Ich lese etwas über Kindereiend. Nicht „Versailles“, sondern „Geld“! Ich lese etwas über Abfallbestrebungen des Rheinlandes. Nicht „Dorten“, sondern „Geld“! Korruption, Zwangswirtschaft, Schiebertum, Sittenverrohung – alles kommt in die Rubrik „Geld“. So, sehe ich die Wirkungen einer in Verfall geratenen Währung an. Es gibt kaum ein Gebiet der Volkswirtschaft, ja selbst der Politik, das sich diesen Wirkungen entziehen kann.
Schlechtes Geld ist, ich wiederhole es, so ziemlich das größte Unglück, das ein Volk treffen kann. Der für Deutschland so unglückliche Ausgang des Weltkriegs stellt gewiss eine Katastrophe dar, wie sie ein Volk nur alle paar hundert Jahre einmal erlebt. Und doch weiß ich nicht, was im Moment verhängnisvoller für Deutschland ist, die Kriegstragödie oder die Geldkomödie. Freilich, die unheilvollen politischen und wirtschaftlichen Kriegsfolgen bleiben für lange, lange Zeit bestehen, die Geldentwertung und ihre Wirkungen dagegen gehen vorbei oder werden wenigstens in einigen Jahrzehnten nicht mehr in ihrer ganzen Schwere empfunden; der Enkel des Mannes, der heute enteignet worden ist, wächst als Proletarier auf und meint, es müsse so sein. Aber heute ist das Währungselend Deutschlands furchtbarste Geißel, wobei es vielleicht einigen Trost gewährt, daß auch andere Länder diese Geißel spüren.
So, mein lieber James, jetzt weißt Du, was „Geld“ ist! Es ist keineswegs alles, was Du wissen musst, bevor Du reif für den Posten eines Bankdirektors bist, das heißt eines Bankdirektors, wie ich ihn mir vorstelle. Es ist lediglich die Eingangspforte zum Bankwesen, zum Geldmarkt, zur Börse, zum Unternehmertum, die ich Dir in der hiermit beendeten Briefserie geöffnet habe; und sogar erst halb geöffnet habe, denn wir haben bisher nur über das Geld im Lande selbst, über den sogenannten „Binnenwert“ des Geldes gesprochen, nicht über den „Außenwert“, die Valuta. Wenn Gott will, so holen wir diese Versäumnis bald nach.
Somit erkläre ich die erste Lektion für beendet und lege die Feder nieder.
In alter Liebe
Dein Papa.
[1] Der Leser wird gebeten, das Datum zu beachten, an dem dieser Brief geschrieben wurde.
[2] Zu beachten: Der Brief datiert vom Januar 1921.
